




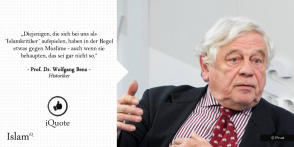
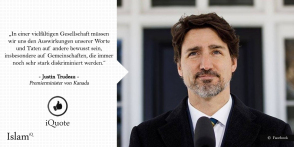

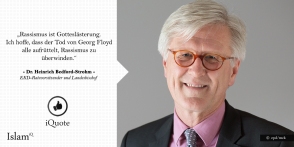

Der aktuelle Rassismusmonitor zeigt: Mehr als jede zweite Muslimin erlebt mindestens einmal im Monat Diskriminierung. Im IslamiQ-Interview sprechen wir mit der Autorin Klara Podkowik über Ursachen, Folgen und politische Verantwortung.

IslamiQ: Mehr als jede zweite Muslimin erlebte mindestens einmal im Monat Diskriminierung. Das ist erschreckend. Oder wie würden sie es beschreiben?
Klara Podkowik: Die Diskriminierungserfahrungen von Muslim*innen in Deutschland sind in der Tat erschreckend. Doch wenn man auf die Forderungen der betroffenen Menschen hört, die bereits seit Jahrzehnten bestehen, ist dieses Ergebnis weniger überraschend. Viele der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind – insbesondere Rassismus und Sexismus – wurden in den letzten Jahren immer gesellschaftsfähiger und treten immer offener zutage, worauf rassistisch markierte Menschen schon lange aufmerksam machen. In Deutschland scheint es jedoch eine Tendenz zu geben, gerade bei diesen Themen wegzuschauen.
IslamiQ: Der Rassismusmonitor zeigt einen Vertrauensverlust in staatliche Institutionen, insbesondere unter Menschen mit Diskriminierungserfahrungen. Das wirkt sich doch sicherlich auch langfristig negativ auf gesellschaftliche Strukturen aus?
Podkowik: Da Politische Institutionen auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen sind, um ihre Handlungsfähigkeit zu legitimieren, ist der Vertrauensverlust folgenreich für das Funktionieren einer Demokratie. Langfristig könnte dies dazu führen, dass sich immer mehr Menschen von der Politik abwenden, seltener wählen gehen und sich von politisch moderaten Parteien distanzieren. Diese Entwicklung öffnet den Raum für Parteien, die vermeintlich einfache Lösungen für komplexe Probleme anbieten. Diskriminierung und Rassismus führen bei rassistisch markierten Menschen häufig zu einem Vertrauensverlust in die Gesellschaft, wodurch ihre Teilhabe, ihr Gemeinschaftsgefühl und ihre Handlungsmöglichkeiten beeinträchtigt werden. Politische und gesellschaftliche Institutionen sollten sich mit der Entstehung dieser Prozesse und ihrem eigenen Anteil daran auseinandersetzen.
IslamiQ: Der Wahlkampf wurde weitgehend vom Thema Migration dominiert. Welche politischen Maßnahmen im Kampf gegen die steigende Islamfeindlichkeit würden Sie der neuen Bundesregierung empfehlen?
Podkowik: Der Wahlkampf wurde nicht nur von Migrationsthemen dominiert, sondern insbesondere durch die Verknüpfung von Migration mit Sicherheitsfragen geprägt. Es ist daher wichtig, dass politische Akteur*innen verantwortungsbewusst mit ihrer Rhetorik und Themensetzung umgehen und Migration nicht primär im Kontext von Sicherheit und Terrorismus diskutieren. Statt sich von rechten Narrativen treiben zu lassen, sollte die Debatte versachlicht und stärker auf soziale Gerechtigkeit fokussiert werden. Um dem steigenden antimuslimischen Rassismus mit konkreten Maßnahmen zu begegnen, sollte die neue Bundesregierung außerdem verstärkt auf rassismussensible Bildung und Aufklärung setzen, um Vorurteile und Feindbilder abzubauen. Ebenso braucht es eine konsequente Stärkung des Antidiskriminierungsschutzes sowie eine stärkere Sensibilisierung von z.B. Medienakteur*innen für diskriminierende Inhalte, um antimuslimischen Rassismus auch auf diesem Weg zu bekämpfen.
IslamiQ: Viele Menschen empfinden Deutschland als eine offene Gesellschaft. Wie erklären Sie die Diskrepanz zwischen diesem Selbstbild und den dokumentierten Diskriminierungserfahrungen?
Podkowik: Deutschland ist ein postmigrantisches Einwanderungsland mit einer diversen Bevölkerung – doch was als „offen“ empfunden wird, hängt stark von der eigenen gesellschaftlichen Position ab. Während viele Menschen die Gesellschaft als offen wahrnehmen, zeigen unsere Daten: Mehr als jede zweite rassistisch markierte Person erlebt regelmäßig Diskriminierung – für viele ist Rassismus kein Randphänomen, sondern Alltag. Gleichzeitig werden politische und mediale Debatten über die potenzielle Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft sowie die zunehmende Versicherheitlichung der Migrationspolitik geführt, die explizit auf eine Einschränkung dieser Offenheit abzielen. Was als „offen“ gilt, ist also auch eine Frage der Perspektive: Wer nicht von rassistischen Zuschreibungen betroffen ist, erlebt rassistische Diskriminierung auch nicht – und unterschätzt diese potenziell.
IslamiQ: Welche Ansätze sehen Sie, um bestehende Machtstrukturen und Diskriminierungsmechanismen in Deutschland kritisch zu hinterfragen und nachhaltig zu verändern?
Podkowik: Der Monitoringbericht macht deutlich: Rassismus ist in vielen gesellschaftlichen Bereichen gegenwärtig und wirkt sich auf die Betroffenen in zahlreichen Situationen und Lebensbereichen aus – sei es in der Öffentlichkeit, in der Freizeit oder im Kontakt mit Behörden. Um dem wirksam zu begegnen, braucht es politischen Willen, institutionelle Reformen und breite gesellschaftliche Sensibilisierung. Unsere Empfehlungen setzen daher auf mehreren Ebenen an – von rassismuskritischer Aus- und Weiterbildung über unabhängige Beschwerdestellen bis hin zu diskriminierungssensibler Gesundheitsversorgung und psychosoziale Unterstützungsangebote für Betroffene. Zudem braucht es eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), um den Rechtsschutz zu verbessern und konsequent durchzusetzen. Zentral ist auch eine langfristige Bildungsstrategie, die moderne Formen von Rassismus sichtbar macht und gleichberechtigte Teilhabe stärkt.
IslamiQ: Welche konkreten Schritte werden nun unternommen, um Rassismus und Ausgrenzung wirksam zu bekämpfen?
Podkowik: Trotz bestehender gesetzlicher Rahmenbedingungen wie dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und zivilgesellschaftlicher Initiativen zur Bekämpfung von Diskriminierung bleibt die Umsetzung effektiver Maßnahmen gegen Rassismus und Ausgrenzung in Deutschland unzureichend. Dabei sind bestehende staatliche und zivilgesellschaftliche Akteur*innen die in diesem Kontext arbeiten durch akute oder drohende Kürzung finanzieller Förderung bedroht. Mit der Einrichtung des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors (NaDiRa) wurde ein erster Schritt unternommen, um empirisch fundierte Erkenntnisse über Ursachen, Ausmaß und Folgen von Rassismus und Diskriminierung in Deutschland bereitzustellen. Die Verstetigung von Datenerhebung und Forschung ist dabei eine wesentliche Grundlage für evidenzbasierte Antidiskriminierungsstrategien und die Institutionalisierung der Rassismusforschung. Angesichts erheblicher Defizite ist es dringend erforderlich, dass die Politik wirksame Schritte entwickelt, um Rassismus und Ausgrenzung entgegenzuwirken.
IslamiQ: Wie können sie sicherstellen, dass der Rassismusmonitor nicht nur eine Dokumentation von Diskriminierung und Rassismus ist, sondern auch einen Beitrag zur Entwicklung von Strategien für eine inklusivere und gerechtere Gesellschaft leistet?
Podkowik: Um Strategien für eine inklusivere und gerechtere Gesellschaft zu entwickeln, stellt der Rassismusmonitor eine empirische Grundlage bereit, aus der konkrete politische Handlungsempfehlungen hervorgehen. Er trägt zu einer bereiteren gesellschaftlichen Auseinandersetzung und Sichtbarmachung von Diskriminierung und Rassismus aus Betroffenenperspektive in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Bildung und Gesundheit bei. In Reaktion auf den Bericht Rassismus und seine Symptome wurde beispielsweise eine rassismuskritische Beratung an der Universität zu Köln eingerichtet. Zudem soll, basierend auf dem aktuellen Monitoringbericht, im Berliner Senat eine Stelle für eine Ansprechperson für antimuslimischen Rassismus geschaffen werden.
Das Interview führte Enes Bayram und Kübra Layık.