







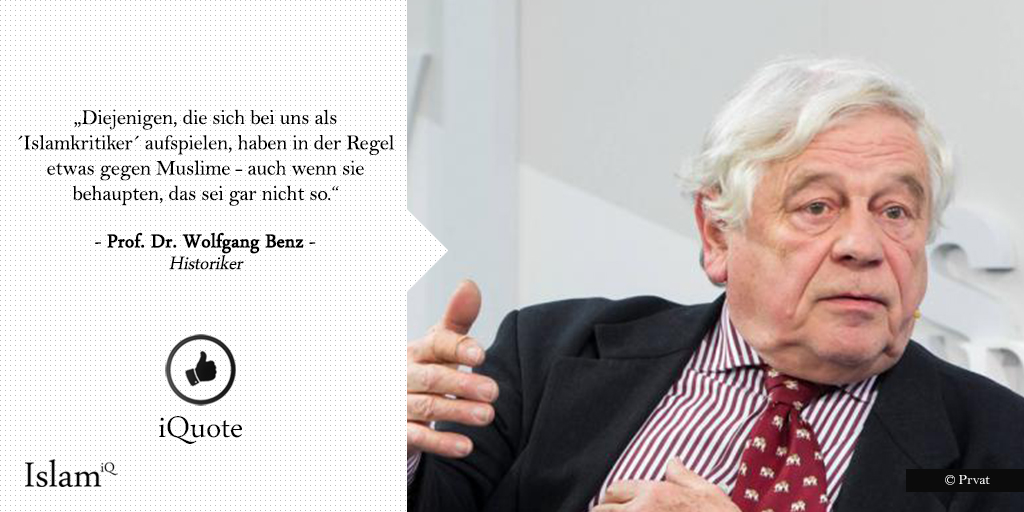

Am 19. Februar jährt sich der rassistische Anschlag in Hanau. Wie geht es Betroffenen heute? Experten sehen den Kampf gegen Rassismus noch ganz am Anfang.

Ajla Kurtović erinnert sich minuziös an den Morgen, an dem sie und ihre Familie vom Tod ihres Bruders erfuhren. Der 22-jährige Hamza Kurtović gehört zu den Todesopfern des Anschlags vom 19. Februar 2020 in Hanau. Ein 43-jähriger Deutscher erschoss an jenem Abend aus rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln, bevor er vermutlich seine Mutter und sich selbst tötete.
Von einer Liste waren am folgenden Morgen die Namen der Menschen verlesen worden, die das Attentat nicht überlebt haben – und Hamza war dabei. „In diesem Moment ist für uns die Welt stehengeblieben“, sagt seine Schwester am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zu den Hintergründen und den Folgen des Anschlags.
Seit der Tat pocht die Steuerfachwirtin auf eine lückenlose Aufklärung der Tat. Sie benennt viele Fragen, die danach für sie und ihre Familie offen geblieben sind – allen voran die, warum die Tat trotz verschiedener „Warnsignalen“ vor dem Anschlag nicht verhindert wurde. So soll der Täter vor dem Attentat Pamphlete mit Verschwörungsmythen und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht haben.
Zugleich macht sich Kurtović für ein gemeinsames Eintreten gegen Rassismus und Rechtsextremismus stark. „Ich glaube, es ist für uns als Gesellschaft und für uns als Betroffene wichtig, die Geschichte immer und immer wieder zu erzählen und an die Opfer zu erinnern, um den Menschen klarzumachen, was wirklich in der Tatnacht passiert ist und dass wir zusammenhalten müssen“, sagt sie. Der Täter habe mit der Tat eine Spaltung bewirken wollen. „Man muss irgendwie versuchen, dagegen zu stehen.“
Aus Sicht des Soziologen Matthias Quent steht der Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus auch ein Jahr nach dem Attentat von Hanau in Deutschland erst am Anfang. „Wir stehen am Anfang eines langen Lernprozesses als Gesellschaft, auch die Behörden“, sagte der Leiter des Jenaer Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft. Im Rahmen dieses Prozesses müssten die Stimmen von Betroffenen und zivilgesellschaftlichen Initiativen gehört und Opferberatungsgesellschaften gestärkt werden, „um der Zunahme von rassistischer und ja dann auch rechter Gewalt überhaupt Herr zu werden“.
Positiv wertete Quent konkrete Schritte wie etwa den Anfang Dezember vom Bundeskabinett verabschiedeten 89-Punkte-Plan der Bundesregierung. Er habe den Eindruck, dass „man hier verstanden hat, dass Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, und dass man eben nicht auf vermeintliche Zugehörigkeiten oder Bezüge zu rechtsextremen Strukturen reduzieren darf.“ Es liege in der Hand der Gesellschaft, die Wahrscheinlichkeit zur Entstehung von rassistischer Gewalt zu minimieren, sagte Quent. „Das bedeutet nicht, dass man solche Angriffe, Attacken verhindern kann.“ Der Weg sei sehr lang, „weil wir jetzt erst anfangen, einigermaßen offen über die unterschiedlichen Formen von Alltagsrassismus, institutionellem und strukturellem Rassismus öffentlich – das heißt nicht akademisch und nicht nur in den Kreisen von Betroffenen von Rassismus – zu diskutieren“. Wichtig sei sowohl die Solidarität mit Betroffenen als auch die Ächtung jeglicher Form von Rassismus.
Auch der Hanauer Opferbeauftragte Andreas Jäger sieht seine Heimatstadt, aber auch die gesamte Gesellschaft vor einer großen Aufgabe: „Ich glaube, dass wir nach vorne gerichtet schon jeden Tag darum kämpfen müssen, die Demokratie zu verteidigen“, sagte Jäger. Es gelte, klarzumachen, dass Meinungsfreiheit, Demokratie, das Miteinander verschiedener Kulturen, gegenseitige Akzeptanz und Respekt ein hohes Gut seien. Um dies noch stärker in den Blick zu nehmen, sei auch das Zentrum für Demokratie und Vielfalt in Hanau auf den Weg gebracht worden, das dazu beitragen solle, Demokratie auch erlebbar zu machen, sagte Jäger. Man wolle zuhören, Probleme aufnehmen und bestmöglich an der Seite der Familien stehen.