







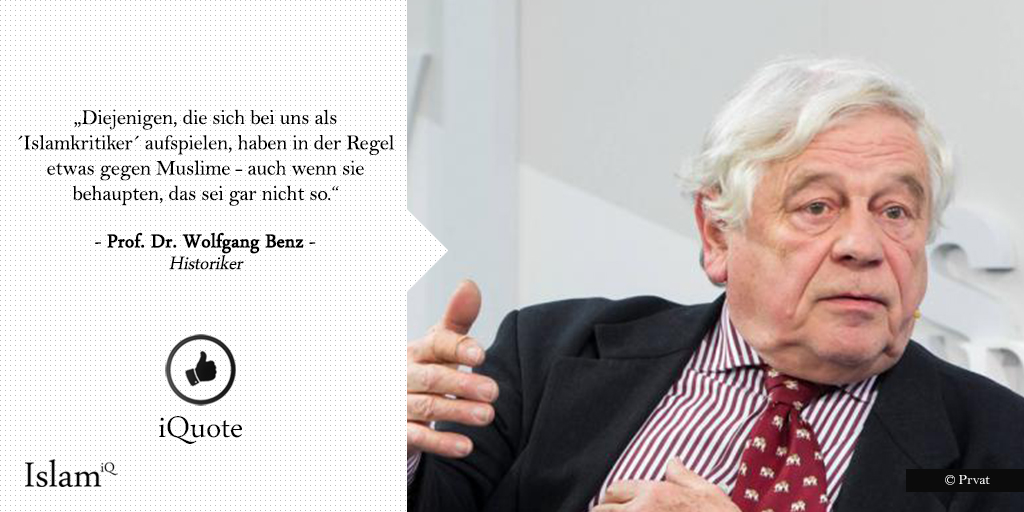

Rassismus und Diskriminierung gibt es überall. Auch unter Schülern und Lehrern. Wie kann er erkannt und bewältigt werden? Ein Gespräch mit dem Rassismusforscher Prof. Dr. Karim Fereidooni.

IslamiQ: Warum ist Diskriminierung in der Schule ein besonders relevantes Thema?
Prof. Karim Fereidooni: Weil die Schule den Anspruch hat, für alle Menschen da zu sein, egal welcher faktischen oder zugeschriebenen Herkunft. Außerdem hat die Schule an sich den normativen Anspruch der Gleichbehandlung, da sie eine staatliche Institution ist und das Grundgesetz und der Diskriminierungsschutz hier besondere Geltung haben.
Ausgehend von meiner Studie über Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen von ReferendarInnen und LehrerInnen „mit Migrationshintergrund“ bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass LehrerInnen und SchülerInnen identische Rassismuserfahrungen machen. Ein Beispiel: An einigen Schulen ist es verboten, eine nichtdeutsche Sprache auf dem Schulhof zu sprechen. Davon sind auch Lehrkräfte im LehrerInnenzimmer betroffen. Natürlich sind nicht alle nichtdeutschen Sprachen wie Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Griechisch von diesem Verbot betroffen, sondern nur diejenigen Sprachen, denen kein oder nur ein geringer Bildungswert beigemessen wird wie Türkisch, Russisch, Farsi, Kurdisch etc. Sanktionsmaßnahmen betreffen sowohl die SchülerInnen als auch die Lehrkräfte. Rassismus ist ein relevantes Thema, über das gesprochen werden muss.
IslamiQ: Wie reagieren SchülerInnen auf Rassismus, wenn dieser von ihren LehrerInnen ausgeht?
Fereidooni: Die Studie von Wiebke Scharathow zu dieser Thematik besagt, dass SchülerInnen ganz unterschiedlich reagieren. Einige wehren sich dagegen, andere möchten sich zwar wehren, aber haben Angst vor den Konsequenzen. Was ich ganz besonders interessant finde ist, dass einige SchülerInnen Diskriminierung bzw. Rassismus gar nicht wahrnehmen.
Aufgrund meiner Forschungsbefunde kann ich schlussfolgern, dass über Rassismus in Gesellschaft und Schule ungern gesprochen wird. Man glaubt, man sei nicht das Problem, sondern Teil der Lösung, weil man der Ansicht ist, nur Rechtsextreme oder AfD-WählerInnen seien rassistisch. Hinzu kommt der Glaube, dass es Rassismus nur in der Zeit von 1933-1945 gegeben habe und heutzutage kein Rassismus mehr existiert. Selbstverständlich besteht einen Unterschied zwischen Staatsrassismus (1933-1945) und Alltagsrassismus (seit 1945), aber nach wie vor werden Menschen in der BRD rassistisch diskriminiert.
Rassismus begegnet uns heutzutage nicht mehr in seiner biologistischen Form. Die Lehrkräfte werden weniger Aussagen tätigen wie, „meine schwarzen SchülerInnen sind generell dümmer als meine weißen SchülerInnen“. Solche Sätze sind nicht (mehr) salonfähig. Gesellschaftsfähig sind Sätze wie: „Ich weiß gar nicht, ob meine jungen muslimischen Schüler mich als weibliche Lehrkraft akzeptieren. Das hat was mit dem Islam zu tun“ oder: „Ich bin mir unsicher, ob die jungen geflüchteten muslimischen Männer fähig sind, demokratische Spielregeln zu erlernen“.
IslamiQ: Was ist denn der Unterschied zwischen Rassismus und Diskriminierung?
Fereidooni: Rassismus ist eine spezielle Spielart von Diskriminierung, die die faktische oder zugeschriebene Herkunft fokussiert und diese dann abwertet. Rassismus bezieht sich also auf Herkunft und Herkunftskonstruktionen in Sinne von Rassekonstruktionen. Sie wissen ja, menschliche Rassen gibt es nicht. Der biologistische Rassismus hat aber menschliche Rassen erfunden, um Menschen ausbeuten zu können. Rassismus ist somit eine Legitimierungsgrundlage, um Menschen zu unterdrücken.
Diskriminierung hingegen ist sehr breit gefächert. Diskriminiert werden können Menschen aufgrund des Geschlechts (Sexismus), aufgrund des sozialen Status (Klassismus), weil man scheinbar dem Schönheitsideal der betreffenden Gesellschaft nicht genügt (Bodyism), aufgrund der sexuellen Orientierung (Heteronormativität) etc.
IslamiQ: LehrerInnen berichten uns, dass sie während des Referendariats diskriminiert wurden, dies aber abnahm, nachdem sie verbeamtet wurden. Wie sehen Sie das?
Fereidooni: Viele angehende LehrerInnen, unabhängig ihrer faktischen oder zugeschriebenen Herkunft, empfinden das Referendariat als schwierige bzw. schwierigste Phase ihres Lebens. Was beim faktischen oder zugeschriebenen Migrationshintergrund hinzukommt, ist die zusätzliche Erklärungsschablone für das Verhalten der jeweiligen Person. Migrationshintergrund wird als Füllwort für alle möglichen negativen Dinge benutzt, wie beispielsweise: „Er macht seine Hausaufgaben nicht. Er hat einen Migrationshintergrund“. „Er respektiert die Lehrer nicht, er hat einen Migrationshintergrund.“ „Er macht Fehler an der Tafel, weil er ein Migrant ist.“
Während die Phase des Studiums für die meisten LehrerInnen als eine sehr freie Zeit wahrgenommen wird, ist das Referendariat sehr durchgetaktet. Außerdem werden während des Referendariats unterschiedliche Rollenerwartungen an die künftigen LehrerInnen gestellt. Mal ist man Lehrkraft (beim eigenständigen Unterricht vor der Schulklasse) und im Studienseminar ist man wieder SchülerIn. Diese Beziehung zwischen ReferendarInnen und FachleiterInnen wird zum Teil als sehr schwierig wahrgenommen.
IslamiQ: Laut Ihrer Studie werden LehrerInnen öfter von Kollegen diskriminiert als von Schülern.
Fereidooni: In meiner Studie werden die 159 untersuchten LehrerInnen – und das war für mich ein überraschender Befund – nicht vornehmlich von ihren SchülerInnen oder deren Eltern rassistisch diskriminiert. Zum einen liegt das daran, dass die SchülerInnen bemüht sind, gute Noten zu erlangen, und zum anderen daran, dass es zu wenig Kontaktzeit zwischen Eltern und LehrerInnen gibt.
Vorgesetzte und Kollegen diskriminieren zwar oft, aber helfen auch oft bei Rassismuserfahrungen. Das überrascht jetzt ein wenig, aber es ist wirklich so. Das sind die primären Ansprechpartner der Lehrkräfte, die Rassismuserfahrungen machen. Diesen Umstand nutze ich, um Rassismuskritik bereits in der universitären Ausbildungsphase angehender PolitiklehrerInnen zu thematisieren.
IslamiQ: Wie gehen LehrerInnen mit Diskriminierung um?
Fereidooni: Das ist ganz unterschiedlich. Die einen passen sich an, indem sie sich verändern. Ich habe zum Beispiel Frauen interviewt, die ein Kopftuch tragen und das zu einer Zeit, in der es noch einen Kopftucherlass in NRW gab. Nach wie vor gibt es in einigen Bundesländern sogenannten „Kopftuchverbote“. Diese besagen, dass ReferendarInnen mit Kopftuch unterrichten dürfen, aber fertig ausgebildete LehrerInnen nicht. Innerhalb dieser Kopftucherlasse gibt es dann noch Unterschiede wie z. B. das laizistische Modell in Berlin, wo jegliche religiöse Symbole verboten sind, oder das sogenannte christlich-jüdisch-abendländische Modell in Bayern und im Saarland, wo die jüdische Kippa und die Nonnentracht vom Verbot ausgenommen ist. Nur das muslimische Kopftuch ist verboten. Es besteht also eine Ungleichbehandlung zwischen den unterschiedlichen religiösen Symbolen in Schule und Gesellschaft.
Einige Frauen nehmen das Kopftuch ab, andere wiederrum sagten dann: „Ne, ich habe das Referendariat gemacht und wenn die mich so nicht haben wollen, dann eben nicht. Dann werde ich lieber arbeitslos, als das Kopftuch aufzugeben.
Man kann nicht vom Kopftuchtragen auf eine extremistische Position schließen. Die allermeisten Frauen, die nach den Gründen für das Kopftuch tragen befragt worden sind, tragen es freiwillig. Einige sogar gegen den Willen ihrer Eltern. Selbstverständlich werden auch einige Frauen gezwungen es zu tragen, aber das sind sehr wenige.
Einige LehrerInnen distanzieren sich von ihren KollegInnen andere wiederrum wenden Humor an, um mit solchen negativen Erfahrungen klarzukommen. Andere LehrerInnen sind sehr idealistisch. Es gibt LehrerInnen, die ich als change agents bezeichnen würde. Die haben Rassismuserfahrungen als SchülerInnen erlebt und wollen es als Lehrkraft anders machen.
IslamiQ: Was würden Sie den Personen empfehlen, die in der Schule diskriminiert worden sind?
Fereidooni: Das ist eine sehr wichtige, aber sehr schwierige Frage, weil nur das Land Berlin eine unabhängige Beschwerdestelle hat. Man kann sich natürlich an diverse Vereine wenden wie beispielsweise die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, an ARIC e.V. Duisburg, das Antidiskriminierungsbüro Köln und so weiter. Generell ist es schwierig, etwas gegen Rassismus zu unternehmen, weil in der Schule Machtasymmetrien vorhanden sind und es in NRW beispielsweise keine unabhängigen Diskriminierungsstellen gibt, die weisungsbefugt sind und das Recht haben, in bestehende Strukturen einzugreifen.
Ich empfehle diesen Personen sich an die Beratungsstellen zu wenden und sich auch juristischen Rat von den Gewerkschaften einzuholen.
IslamiQ: An wen können sich diskriminierte LehrerInnen und SchülerInnen wenden?
Fereidooni: Auf der einen Seite würde ich den Lehrkräften raten, zu schauen, ob es sich lohnt, sich zu wehren. Denn manchmal kann „Aussitzen“ erfolgreicher sein als sich gegen Rassismus zu wehren. Das heißt die Zähne zusammenbeißen und die 1,5 Jahre Referendariat überstehen, ist manchmal besser als eine Klage oder die vorzeitige Beendigung des Vorbereitungsdienstes ohne Abschluss. Nicht zu reagieren kann manchmal sinnvoller sein, als sich in unterschiedlichen Kämpfen wiederzufinden. Wenn man nicht klar beweisen kann, dass man rassistisch diskriminiert worden ist, dann würde ich eher sagen: Augen zu und durch.
Bei Schülern sieht das anders aus. Hier ist die Präsenz von Eltern im deutschen Schulwesen ganz wichtig. Ich war selber sechs Jahre Lehrer und kann Ihnen sagen, dass ein wenig Druck auf die Lehrkräfte gut ist. Personen mit Migrationshintergrund müssen präsent sein, beim Elternsprechtag und bei anderen schulischen Aktivitäten. Und diese Eltern müssen den LehrerInnen signalisieren, dass sie sich um ihre Kinder kümmern. Das hat eine ganz starke Auswirkung auf die Notengebung der Lehrkräfte. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
Woraus resultiert Bildungsdiskriminierung? Unter anderem, weil bei gleichem Notendurchschnitt Personen benachteiligt werden, weil Lehrkräfte bei Übergangsempfehlungen einen Aspekt in ihre Gesamtrechnung mit hineinnehmen, die man gar nicht beziffern kann, und das ist der Glaube daran, dass die Eltern das Kind auf der weiterführenden Schule unterstützen können. Daher würde ich jedem Elternteil mit faktischem oder zugeschriebenen Migrationshintergrund raten, verstärkt in die Schulen zu gehen und zu signalisieren: „Ich bin für mein Kind da und möchte, dass mein Kind bildungserfolgreich wird. Ich unterstütze mein Kind“.