







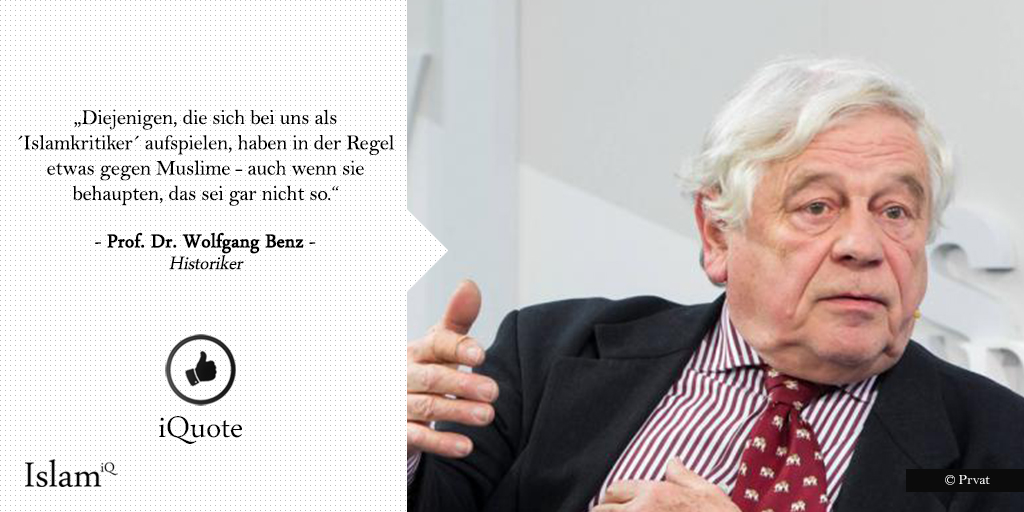

Vor 10 Jahren wurde die Deutsche Islam Konferenz (DIK) einberufen. IslamiQ beleuchtet in einer Beitragsreihe die Hintergründe und Entwicklungen. Heute ein Interview mit Prof. Dr. Schirin Amir-Moazami über die DIK und den Dialog zwischen Staat und Muslime.

IslamiQ: Habermas setzt für einen herrschaftsfreien Diskurs voraus, dass die Kommunikationspartner gleichberechtigt sind und ein symmetrischer Dialog stattfindet. Trifft dies auf die DIK zu?
Schirin Amir-Moazami: Nein, überhaupt nicht. Lassen wir hier einmal außer Acht, dass herrschaftsfreie Diskurse allgemein bestenfalls in der Theorie, nie aber in der politischen Wirklichkeit möglich sind und wenden uns der DIK als politischer Praxis zu. Die Initiative war von Anfang an asymmetrisch: Der Staat hat entschieden, dass es neben dem allgemeinen Integrationsgipfel einen besonderen Gipfel für Muslime geben müsse. Der Staat entscheidet über die Ansprechpartner. Er entscheidet über die Agenda und noch wichtiger, er legt auch die Ziele fest, die aus dem Dialog resultieren sollen.
Die wohlwollende Geste zum Dialog war also von Anfang an mit staatlicher Deutungshoheit verbunden. Letztlich ist aber auch kaum etwas anderes zu erwarten bei der Konstellation: „Staat lädt Muslime an den Tisch der Republik“. Allerdings hätte es sich um einen egalitäreren Austausch handeln können, wenn es tatsächlich um einen Austausch unterschiedlicher Argumente gegangen wäre. Das der DIK innewohnende Integrationsparadigma ist aber darauf nicht ausgerichtet. Vor allem in den ersten Jahren hat man sich einseitig auf sogenannte Integrationsdefizite von Muslimen konzentriert und daher die Fragen nur in eine Richtung gelenkt: „Was stimmt nicht mit dem Islam und wie lässt es sich er als Integrationsressource nutzen?“ Das scheint sich in den letzten Jahren ein wenig verschoben zu haben. Die Machtasymmetrien sind damit aber nicht verschwunden, vor allem weil die ganze Initiative einem zivilisatorischen Impetus folgt: „Sprecht als Muslime, aber werdet so wie wir gern wären!“
IslamiQ: Sie schreiben in einem Aufsatz, dass die DIK ein einseitiges Agenda-Setting und eine einseitige Einladungspolitik verfolgt. Woran kann man das festmachen?
Amir-Moazami: Schäuble, der Initiator der DIK, hat die Agenda gleich zu Beginn recht deutlich gemacht, indem er Themen wie „Islamismus“, „Geschlechternomen“ oder „Grundrechte“ einseitig als Problemfelder von Muslimen ausgemacht hat. Ich glaube übrigens nicht einmal, dass dies nur böswillige Strategie war oder ist, sondern letztlich Ausdruck tiefsitzender Diskurse über den Islam und Muslime in diesem Land, die lange vor der DIK virulent waren.
Offiziell heißt es immer, es werden Muslime ganz unterschiedlicher Couleur eingeladen, um die „Vielfalt“ der Muslime in Deutschland abzubilden. Sieht man sich die Zusammensetzung der vertretenen MuslimInnen vor allem in der ersten Runde an, so scheint es allerdings, dass jeder/m dieser VertreterInnen eine bestimmte Rolle zugedacht wurde. So sollten die sogenannten „Islamkritikerinnen“ den männlich dominierten Verbandsvertretern Geschlechtergleichheit beibringen; „Islamismusexperten“ indes sollten mit islamischen Gemeinschaften „Sicherheitspartnerschaften“ bilden. Das hat schwerlich funktioniert. Obwohl die DIK in der gegenwärtigen Konstellation weitaus weniger inszeniert erscheint, hat sich an den Machtasymmetrien nichts geändert. Es sind immer noch die staatlichen Vertreter, die sich aussuchen, mit wem sie sprechen wollen, wie und worüber.
IslamiQ: Islamische Grundbegriffe wie „Dschihad“ oder „Scharia“ sind in der deutschen Öffentlichkeit eindeutig negativ konnotiert. Der Dialog zwischen islamischen Religionsgemeinschaften und dem Staat findet unter dem Schatten dieser „negativen“ Begriffe statt, die im Rahmen der Sicherheitspolitik bekämpft werden sollen. Wie können Muslime die Deutungshoheit über ihre Begrifflichkeiten wiedererlangen?
Amir-Moazami: Das ist eine sehr gute Frage, meine Antwort darauf aber leider eher ernüchternd. An der Frage, welche Begriffe auf welche Weise in der Öffentlichkeit zirkulieren, hängt ja die weitläufigere Frage nach den Artikulationsmöglichkeiten und -bedingungen von marginalisierten Stimmen in liberalen Nationalstaaten. Dass jeder seine Meinung frei äußern kann, bedeutet noch lange nicht, dass alles, was gesagt auch gehört wird oder in den öffentlichen Diskurs Eingang findet. Die Deutung von Begriffen ist damit jenen vorbehalten, die Zugang zur Öffentlichkeit haben.
Die Digitalisierung hat hier nichts Grundsätzliches verändert. Im Gegenteil: Sowohl mobilisierungsträchtige Terrornetzwerke, die sich als islamische Kämpfer gerieren, als auch rechtsradikale Bewegungen nutzen diese medialen Räume schrill und teils blutrünstig. Damit geben sie den Negativkonnotationen islamischer Begriffe auf unterschiedliche Weise Futter. Die öffentliche Meinung kann also jederzeit Belege finden. In der Online-Version der SZ war kürzlich die anrührende Geschichte von einem Syrer zu lesen, der Menschen aus Kriegsgebieten herausholte und rettete – etwa indem er einen Säugling aus den Trümmern eines zerbombten Wohnhauses barg – bis er selbst im Kugelfeuer starb. In Interviews vor seinem Tod hatte er seine Hilfseinsätze als „Dschihad“ deklariert. Bezeichnenderweise hat die Presse hierzulande dieser Dschihad-Version keine weitere Beachtung geschenkt. Es wird also meistens nur das gehört, was geläufige Vorannahmen bestätigt.
Es ist generell sehr schwer, eingeschliffene Diskurse zu verändern, die ja auch mit einverleibten Konventionen des Zuhörens und -sehens verbunden sind. Leider bringt es meistens wenig, mit sogenannter „Sachkenntnis“ zu argumentieren, solange man sein Gegenüber damit nicht zugleich veranlasst, die eigenen Vorannahmen kritisch zu überdenken.
IslamiQ: Das Land Niedersachsen verhandelt seit langem mit islamischen Religionsgemeinschaften über einen Staatsvertrag. Die Verhandlungen sind jedoch in eine Sackgasse geraten. Welche Schwierigkeiten und Herausforderungen birgt der Dialog zwischen Staat und Muslimen?
Amir-Moazami: Neben den immer wieder erwähnten staatskirchenrechtlichen Bedingungen, die eine Anerkennung nicht-christlicher Religionsgemeinschaften erschweren, ist staatliche Anerkennung von marginalisierten Minderheiten grundsätzlich tückisch: Die Minderheit muss mit einer Stimme sprechen, um als Akteur erkennbar und anerkennbar zu sein. Der Staat wiederum legt die Kriterien der Anerkennung fest und gewinnt damit an Souveränität. Im Fall islamischer Gemeinschaften kommt erschwerend hinzu, dass sie sich nicht auf eine Stimme einigen können, ohne dabei immer wieder notwendigerweise jemanden auszuschließen.
Hinzu kommt, dass verantwortliche politische Autoritäten häufig eine unausgesprochene Skepsis gegenüber islamischen Verbänden hegen. Es bedarf also besonderer Mühen der Vertrauensbildung und Muslime geraten dabei immer wieder in die Defensive, weil sie sich ständig zu denselben Fragen äußern müssen, anstatt selbst Forderungen stellen zu können.