




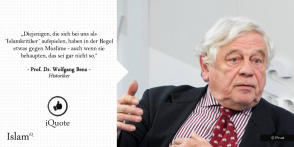
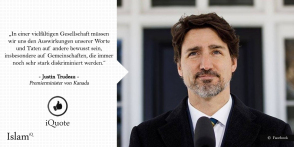

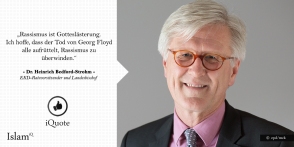

Vor jeder Wahl wird die Debatte rund um das Wählen neu entfacht. Dr. Hakkı Arslan erklärt, warum politische Partizipation keine Glaubensfrage ist – sondern eine Verantwortung für das Gemeinwohl.

Die Frage, ob Muslime an Wahlen teilnehmen dürfen, wird immer wieder kontrovers diskutiert. Besonders im Vorfeld von Wahlen tauchen in sozialen Medien und bestimmten ideologischen Kreisen Behauptungen auf, dass Wahlen haram, ja sogar eine Form von Kufr oder Schirk seien. Doch wie fundiert sind diese Aussagen?
Fakt ist: Die allermeisten Muslime weltweit haben diese Frage bereits längst beantwortet. Kein ernst zu nehmender Gelehrter vertritt die Meinung, dass Wahlen pauschal als haram einzustufen sind. Auch in Deutschland besteht weitgehender Konsens darüber, dass politische Partizipation nicht nur erlaubt, sondern essenziell ist, um die Rechte der Muslime zu wahren und gesellschaftliche Prozesse mitzugestalten.
Gerade in der heutigen Zeit, in der eine rechtsextreme Partei als zweitstärkste Partei den Diskurs über Muslime und Migranten bestimmt und die meisten etablierten Parteien diesen stark rassistischen Diskurs mittragen. In einem prophetischen Hadith heißt es: „Wer von euch etwas Übles sieht, soll es mit eigener Hand ändern, und wenn er dies nicht vermag, so soll er es mit seiner Zunge verändern, und wenn er dies nicht kann, dann mit seinem Herzen, und dies ist die schwächste Form des Glaubens.“ Entsprechend dieser Aussage hält die Mehrheit der sunnitischen Gelehrten weltweit die Teilnahme an Wahlen nicht nur für erlaubt, sondern ruft Muslime – insbesondere in nichtmuslimischen Ländern – ausdrücklich dazu auf, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.
Diese Verantwortung wird nicht nur als Empfehlung verstanden, sondern in bestimmten Situationen sogar als religiöse Pflicht angesehen, um das Wohl der Gemeinschaft zu schützen und Schaden abzuwenden. Sogar die konservativsten islamischen Strömungen sehen in Wahlen ein legitimes Mittel der gesellschaftlichen Partizipation. So erklärt die Deobandi-nahe Fatwa-Seite Darul Ifta: „Wahlen sind nicht verboten. Wenn eine Partei oder ein Kandidat dem Gemeinwohl dient, sollte man seine Stimme abgeben. Und wenn man eine bestimmte Partei wählt, bedeutet das nicht, dass man mit all ihren Ideologien und Überzeugungen einverstanden ist.“[1] Es ist keine Entscheidung für oder gegen die Religion, gegen Gott, sondern eine Abwägung, wer von den gegebenen Kandidaten dem Gemeinwohl mehr dient oder von wem man weniger Schaden erwartet.
Die salafitisch-wahhabitische Plattform Islamweb betont: „Die Wahlteilnahme ist eine Frage der politischen Rechtswissenschaft, die sich an Nutzen und Schaden orientiert.“ Selbst wenn man die Teilnahme an Wahlen in nichtmuslimischen Ländern tendenziell eher verbieten würde, käme es immer darauf an, ob dies im konkreten Fall sinnvoll sei oder nicht, und das könnten nur die Gelehrten in den jeweiligen Ländern entscheiden: „Diese Frage wird von den muslimischen Gelehrten in jedem Land entschieden, weil sie die Umstände in ihrem Land besser kennen.“[2]
Früher lehnten wahabitische Gelehrte demokratische Wahlen strikt ab, aber nachdem vor allem in Ägypten und anderen Staaten salafistisch orientierte Parteien an Wahlen teilgenommen haben und in die Parlamente eingezogen sind, wird dieses Thema pragmatischer und nicht mehr als eine Frage der Glaubenslehre behandelt. Auch der traditionelle Gelehrte Imam Faraz Rabbani, der eher der neotraditionalistischen Richtung zuzuordnen ist, erklärte im Vorfeld der kanadischen Wahlen 2019 zusammen mit 60 anderen Imamen, dass Wahlen eine soziale und religiöse Verantwortung seien, die aus dem Glauben erwachse: das Gute zu fördern und das Böse zu verhindern.
Die bewusste Auswahl dieser Quellen zeigt, dass auch in sehr konservativen Kreisen Wahlen nicht abgelehnt, sondern als pragmatische Entscheidung im Sinne des Gemeinwohls betrachtet werden. Die einzige Bewegung, die sich konsequent und pauschal gegen demokratische Wahlen ausspricht, ist die Hizb at-Tahrir und einige kleinere Gruppen sowie einzelne Gelehrte. Sie behaupten, Wahlen seien nicht nur haram, sondern sogar Kufr (Unglaube) oder Schirk (Beigesellung). Diese Ansicht entbehrt jedoch jeder Grundlage in den islamischen Quellen, widerspricht allen anerkannten Koran- und Hadithexegesen und ist mit der 1400-jährigen islamischen Rechts- und Theologietradition nicht vereinbar. Sie ist eine reine Ideologie. Deshalb gibt es unter Muslimen keinen wirklichen Dissens über die Legitimität von Wahlen – die Debatte darüber ist künstlich und wird lediglich für bestimmte Zwecke instrumentalisiert. Die Frage, ob man wählen darf oder nicht, ist keine Frage der Aqida (Glaubenslehre), sondern eine Frage des Fiqh (Normenlehre)!
Das islamische Recht unterscheidet zwischen eindeutigen und interpretationsbedürftigen Normen. In Fällen, in denen keine eindeutige Offenbarung vorliegt und auch keine Präzedenzfälle in den Rechtstexten bekannt sind, wird nach dem Maslaha-Prinzip entschieden, d.h. nach einer Art Nutzen-Schaden-Abwägung. Wenn der Nutzen überwiegt, wird die Handlung je nach Dringlichkeit und Ausmaß der Folgen als empfohlen oder verpflichtend eingestuft. Überwiegt hingegen der Schaden, wird davon abgeraten. Das Maslaha-Prinzip ist kein unwichtiges Prinzip, sondern nach Meinung vieler Gelehrter das oberste Prinzip des islamischen Rechts: „Die Herbeiführung von Nutzen und die Vermeidung von Schaden“ (Dschalb al-manafi wa daf al-mafasid). Alle Gebote und Verbote haben nach diesem Prinzip die Funktion, entweder einen Nutzen herbeizuführen oder einen Schaden abzuwenden. Dementsprechend wird bei jeder Rechtsnorm geprüft, welche Folgen eine Norm nach sich zieht, vor allem dann, wenn es keine expliziten Beweise dafür gibt.
Ein weiteres einschränkendes Fiqh-Prinzip ist, dass die Vermeidung von Schaden und Übel wichtiger ist als die Erlangung von Vorteilen und Nutzen. Im Zusammenhang mit Wahlen bedeutet dies, dass ein ungeeigneter Kandidat an die Macht kommen könnte, wenn die Menschen nicht den am besten geeigneten Kandidaten wählen. Die Wahl eines geeigneten Kandidaten kann daher als Versuch gesehen werden, möglichen Schaden auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene abzuwenden, insbesondere wenn sonst ein islamfeindlicher Kandidat an Einfluss gewinnen würde.
Dies deckt sich auch mit einer weiteren Maxime in dieser Richtung, nämlich: „Wenn jemand von zwei Übeln heimgesucht wird, sollte er das kleinere von beiden wählen“. Das heißt, auch wenn man keine der etablierten Parteien für wählbar hält und sich nicht vertreten fühlt, wäre es auch in einem solchen Fall elementar, wählen zu gehen, um das größere Übel zu verhindern, indem man eine Partei wählt, die nach bestem Wissen und Gewissen weniger Schaden anrichten wird. Dies ist die Meinung, die viele Muslime heute haben, dass keine Partei das Gefühl vermittelt, etwas Gutes bewirken zu können, und es deshalb eher darum geht, das kleinere Übel zu wählen, um den Schaden zu minimieren. Das spricht nicht unbedingt für die derzeitige Parteienlandschaft.
Die Grundregel in zwischenmenschlichen Angelegenheiten lautet: „Eine Sache ist grundsätzlich erlaubt, es sei denn, es gibt einen expliziten Beweis für ein Verbot.“ Wenn das nicht der Fall ist, sind die Folgen und Konsequenzen einer Norm entscheidend.
Viele Gegner von Wahlen zitieren folgenden Vers im Koran: „Und wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat — das sind Ungläubige.“ (Sura Al-Maida, 5:44). Dieser Vers wird jedoch oft aus dem Kontext gerissen. Er bezieht sich auf Menschen, die wissentlich und absichtlich die Gebote Gottes verwerfen und ablehnen. Die Teilnahme an Wahlen in einem nichtmuslimischen Land hat damit nichts zu tun und kann daher nicht als Analogie herangezogen werden.
Die Muslime in Deutschland leben in einem Staat, in dem die Religionsfreiheit verfassungsrechtlich garantiert ist und in dem ihnen umfassende Grundrechte zustehen. Diese verfassungsmäßigen Rechte und Werte bedürfen jedoch einer ständigen aktiven Wahrnehmung und Verteidigung. Der Schutz des Grundgesetzes, die Achtung der Menschenwürde und die aktive Teilnahme am politischen Prozess sind nicht nur gesellschaftliche Verpflichtungen, sondern tragen auch dazu bei, die eigene Religion vor Diskriminierung und Eingriffen zu schützen. Wer sich an diesem Prozess nicht beteiligt, überlässt es anderen, über die Zukunft der Gesellschaft und damit auch über die eigenen Belange zu entscheiden. Natürlich hört die Verantwortung nicht mit den Wahlen auf, sondern man muss sich durchgehend aktiv für das Gemeinwohl einsetzen und verschiedene Wege suchen, um den Dialog zu fördern, sich für Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung einzusetzen. Die Wahlen sind der erste Schritt und müssen als Teil der gesamten gesellschaftlichen Verantwortung gesehen werden.
Die meisten Gelehrten weltweit rufen in verschiedenen Kontexten die Muslime zur Teilnahme an Wahlen auf. Ein Beispiel: Bei den Wahlen 2019 in Indien riefen sunnitische, schiitische, salafistische und darunter sogar rivalisierende Strömungen wie die Deobandis und Barelwis die Muslime auf, ihre Stimme abzugeben, um die hindunationalistische BJP zu verhindern. Das Prinzip dahinter war klar: Schutz des Gemeinwohls und Abwehr von Schaden.
Das Thema Wahlen ist keine Glaubensfrage (Aqida), sondern eine praktische Angelegenheit, die durch islamische Rechtswissenschaft (Fiqh) geregelt wird. Es geht nicht um die Wahl zwischen Gottes Gesetz und einem menschengemachten Gesetz, sondern um eine pragmatische Entscheidung: Welche Partei oder welcher Kandidat bringt mehr Nutzen für die Gesellschaft und insbesondere für die Muslime?
Die absolute Mehrheit der Gelehrten weltweit betrachtet Wahlen als erlaubt oder sogar teilweise als verpflichtend. Nur eine kleine Minderheit verharrt aus ideologischen Gründen auf einer gegensätzlichen Position. Letztlich hat aber jeder Mensch das Recht, frei zu entscheiden, ob er wählen geht oder nicht – etwa weil er von politischen Prozessen und Parteiprogrammen nicht überzeugt ist. Diese persönliche Entscheidung ist ein Akt der Selbstbestimmung. Sie darf aber nicht als religiös-moralisches Argument benutzt werden, um Druck auf andere auszuüben. Die islamische Tradition fordert einen respektvollen Umgang mit Meinungsverschiedenheiten. Was jedoch nicht toleriert werden kann, sind Spaltung und Fanatismus, die zur Verurteilung anderer Muslime führen.
[1] https://daruliftaa.com/miscellaneous/is-voting-permitted-in-islam/
[2] https://www.islamweb.net/en/fatwa/410731/participating-in-elections