




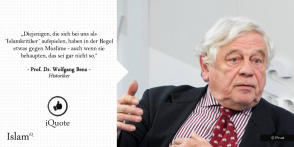
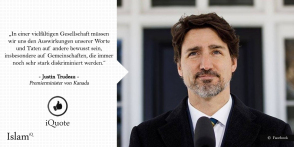

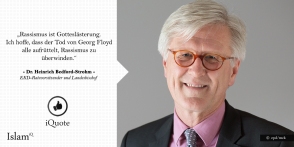

Der islamische Religionsunterricht in Niedersachsen stößt auf wachsendes Interesse. Damit es künftig genug Lehrer gibt, ruft der Landesverband junge Muslime zum Studium der Islamwissenschaften auf. Wie geht es in der Kopftuchfrage für islamische Lehrerinnen weiter?
Der Landesverband der Muslime in Niedersachsen hat Abiturienten zum Studium der Islamwissenschaften aufgerufen, damit es künftig genügend islamische Religionslehrer gibt. Landesweit gebe es ein großes Interesse am Islamunterricht, leider aber fehlten noch immer qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer, teilte der Landesverband nach seiner Hauptversammlung in Hannover mit. An die Mitgliedsvereine sei die deutliche Bitte gerichtet worden, ihre Abiturienten zu ermutigen, ein Lehramtsstudium aufzunehmen mit einer Fächerkombination, in der auch Islam enthalten ist.
Nach einem zehnjährigen Modellversuch wird islamische Religion seit 2013 als Regelfach an Grundschulen und seit dem laufenden Schuljahr auch an weiterführenden Schulen unterrichtet. Dabei wird das Angebot der Nachfrage entsprechend schrittweise ausgebaut. Derzeit gibt es nach Auskunft des Kultusministeriums vom Dienstag 32 islamische Religionslehrer, die an 55 niedersächsischen Schulen fast 2400 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 5 unterrichten. 2200 davon sind Grundschüler.
Als ein Hemmnis bei der Anwerbung von Religionslehrerinnen hatten die Muslime das Kopftuchverbot an den Schulen ausgemacht. Nach den geltenden Regeln dürfen Lehrerinnen das Kopftuch zwar im Islamunterricht, nicht aber in anderen Fächern oder im Schulgebäude oder auf dem Schulhof tragen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte eine flexible Regelung im Rahmen des angestrebten Staatsvertrags mit den Muslimen in Aussicht gestellt.
Als einen Schwerpunkt seiner Arbeit im laufenden Jahr kündigte der muslimische Verband den Einsatz für einen Abbau von Diskriminierungen muslimischer Frauen auf dem Arbeitsmarkt an. Die Zahl der Muslime in Niedersachsen wird auf etwa 200 000 geschätzt, es gibt rund 200 Moscheen und Gebetsstätten. Da die Moscheegemeinden ihre Mitglieder nicht registrieren, gibt es keine exakten Daten.
Dreizehn Jahre nach seiner Gründung trat dem von Sunniten dominierten Landesverband nun auch die schiitische Minderheit bei. Mit der Aufnahme von sechs schiitischen Gemeinden seien beide Konfessionen nun anteilig vertreten, so der Verband. Türkischstämmige Muslime stellen die Mehrheit in den Verbandsgemeinden. Etwa 15 Prozent der Muslime sind Schiiten, vor allem aus dem Iran, Irak, Libanon, Syrien und Afghanistan. (dpa/iQ)