







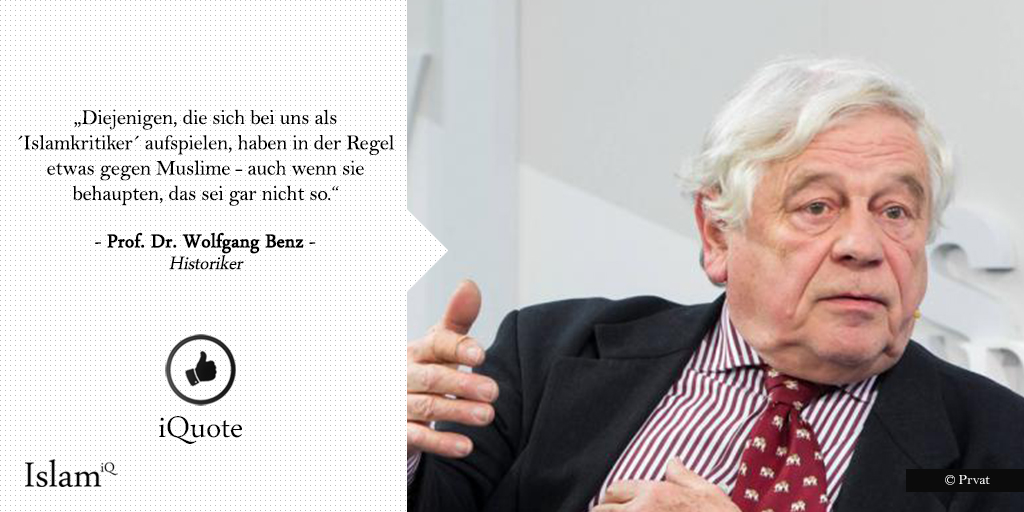

Das Kopftuchverbot an Österreichs Schulen verunsichert Muslime. Viele sprechen von Diskriminierung statt Schutz. IslamiQ hat sie nach Ihrer Meinung gefragt.

Österreich verschärft seine Gangart gegenüber muslimischen Mädchen. Der Nationalrat hat ein Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren beschlossen. Ab dem Schuljahr 2026/2027 dürfen Mädchen kein Kopftuch mehr tragen, das „das Haupt nach islamischen Traditionen verhüllt“.
Familien- und Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) sprach von einem „historischen Schritt zum Schutz von Mädchen“. Das Kopftuch sei kein harmloses Kleidungsstück, sondern ein Zeichen der Unterdrückung.
Doch viele Betroffene sehen das anders. Lehrerinnen, Studierende und Juristinnen warnen vor Stigmatisierung, Ausgrenzung und einem massiven Eingriff in Grundrechte. IslamiQ hat mit vier jungen Menschen gesprochen, die das Verbot aus nächster Nähe betrifft.
Kübra T. ist Lehrerin und erlebt täglich, womit Schulen tatsächlich zu kämpfen haben. Für sie ist das Kopftuchverbot vor allem eines: ein politisches Ablenkungsmanöver. „Das sogenannte Kopftuchverbot fungiert als ein zynisches Ablenkungsmanöver der österreichischen Regierung von tatsächlichen Bildungsproblemen“, sagt sie.
Das Gesetz entziehe Mädchen ihre individuelle Entscheidungsfreiheit und verletze ihr Selbstbestimmungsrecht. Statt Kinder zu stärken, würden muslimische Mädchen auf ein einziges Merkmal reduziert.
„Das Kopftuchverbot stigmatisiert muslimische Mädchen und reduziert ihre gesamte Persönlichkeit sowie ihre Fähigkeiten ausschließlich auf ein Stück Stoff“, kritisiert Kübra. Besonders schwer wiegt für sie der pädagogische Schaden. Schulen würden gezwungen, Sanktionen umzusetzen, statt Schutzräume zu sein. „Das ist kein Schutz der Mädchen, das ist politischer Missbrauch auf Kosten der Mädchen!“
Auch Talha T., Jura-Student, hält die offizielle Begründung für nicht haltbar. Der Staat greife massiv in ein Grundrecht ein, ohne belastbare Daten vorzulegen. „Ein Rechtsstaat greift hier gezielt mit dem Argument, man wolle Kinder vor Zwang schützen, in ein Grundrecht ein – ohne zu wissen, wie viele Mädchen tatsächlich betroffen sind“, sagt Talha. Statt gezielte Hilfsangebote für Betroffene zu schaffen, wähle die Politik den einfachsten Weg: ein pauschales Verbot.
„Anstatt Ombudsstellen, Betreuungsangebote oder rechtliche Vertretung zu schaffen, wird eine gesamte Gruppe über einen Kamm geschoren“, so Talha. Das Ergebnis sei nicht mehr Schutz, sondern eine weitere Spaltung der Gesellschaft – und die Einschränkung jener Mädchen, die das Kopftuch aus eigener Überzeugung tragen.
Süeda I. ist 23 Jahre alt, hat ihr Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen und sieht im Gesetz einen grundlegenden Widerspruch. „Diskriminierung bedeutet, Menschen ihre Freiheit zu nehmen – durch Zwang oder durch Verbote“, sagt sie. Wenn es Unrecht sei, jemanden zum Kopftuch zu zwingen, dann sei es ebenso Unrecht, es zu verbieten. Besonders problematisch findet sie die Ungleichbehandlung religiöser Symbole. Während andere Zeichen erlaubt blieben, werde muslimischen Mädchen ihre Religionsfreiheit genommen – obwohl der Islam in Österreich anerkannt ist.
„Ich bin hier geboren, Staatsbürgerin, studiere, arbeite und zahle Steuern – und soll dennoch wegen meines Kopftuchs ausgeschlossen werden“, sagt Süeda. Integration könne nur gegenseitig funktionieren. Ihr Wert liege in ihrem Denken, nicht in ihrem Aussehen.
Auch die Studentin Rümeysa G. beobachtet die politische Debatte mit wachsender Sorge. Für sie wird immer deutlicher, dass es nicht um das Kindeswohl geht. „Mit jeder weiteren politischen Äußerung verfestigt sich der Eindruck, dass es hier um gezielte Ausgrenzung geht“, sagt sie.
Das Verbot stelle einen tiefen Eingriff in die Religionsfreiheit dar und widerspreche den Grundwerten einer offenen Demokratie. Besonders alarmierend sei, dass Kinder am Ende die Leidtragenden sind.
„Kinder werden sanktioniert und damit instrumentalisiert“, kritisiert Rümeysa. Welche Folgen das für ihr Vertrauen in Schule und Gesellschaft habe, werde politisch kaum thematisiert.
Das Kopftuchverbot wurde mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS beschlossen, auch die FPÖ stimmte zu. Ab Februar 2026 soll eine „Aufklärungsphase“ an Schulen beginnen. Bei Verstößen drohen Gespräche, behördliche Maßnahmen und im äußersten Fall Geldstrafen zwischen 150 und 800 Euro für die Eltern.
Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) kündigte bereits eine Klage beim Verfassungsgerichtshof an. IGGÖ-Präsident Ümit Vural betonte: Kein Kind dürfe zum Kopftuch gedrängt werden – aber ebenso wenig dürfe es durch staatliche Verbote daran gehindert werden, seine religiöse Identität freiwillig zu leben.
Für viele Betroffene bleibt vor allem ein Gefühl zurück: dass über sie gesprochen wird, aber nicht mit ihnen. Und dass ausgerechnet im Namen des Schutzes neue Formen von Ausgrenzung geschaffen werden.