







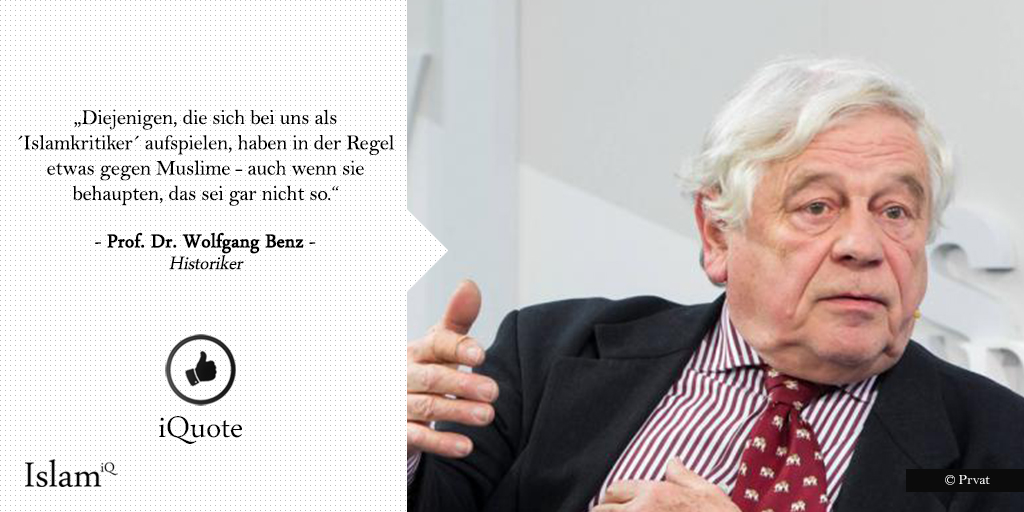

Nach den Anschlägen steckt Großbritannien in einer tiefen Krise. Warum die britische Regierung auf eine Zusammenarbeit mit den Muslimen setzen muss, um die Krise zu überwinden, erklärt der britische Soziologe Chris Allen.

Kurz nach dem Attentat auf der London Bridge Anfang Juni ließ Großbritanniens Premierministerin Theresa May verlauten, „genug sei genug“. Nach dem jüngsten Anschlag auf die Londoner Finsbury Park Moschee, bei dem ein weißer Brite einen Kleinbus in eine Gruppe von Muslimen gesteuert hatte, die nach dem Nachtgebet im Ramadan die Moschee gerade verließ, äußerte sie sich ähnlich, betonte diesmal allerdings die Notwendigkeit der Bekämpfung von Islamhass.
Angesichts einer Welle von Terroranschlägen, bei denen binnen vier Monaten 36 Menschen starben und 200 verletzt wurden, sagte May: „Es gibt, um es offen zu sagen, eine viel zu große Toleranz gegenüber Extremismus in unserem Land.“ Unterstützern von Extremismus müsse deutlich entschiedener entgegen getreten werden. Es sei an der Zeit, so May, „ einige schwierige und unangenehme Gespräche“ zu führen.
Obwohl May sich nicht ausdrücklich auf Muslime bezog, schien für Viele klar, dass sich ihre Worte vor allem an die muslimische Gemeinde Großbritanniens richteten. Sie wurden am Folgetag von Sajid Javad aufgegriffen, dem für die Kommunen zuständigem Minister und gleichzeitig einzigem Muslim in der britischen Regierung. Muslime, so Javid, müssten aufgrund ihrer „besonderen Verantwortung“ mehr für die Bekämpfung von Extremismus tun. Javid ging jedoch noch über diesen Grundtenor hinaus, der die politischen Debatten im Land seit rund einem Jahrzehnt bestimmt. Extremismus sei eben nicht nur das Problem einiger weniger Radikaler innerhalb der muslimischen Gemeinde Großbritanniens, sondern würde von einer „weitaus größeren Zahl“ ihrer Mitglieder mitgetragen und geduldet.
Solche Unterstellungen beschränken sich nicht auf den politischen Raum. Noch viel deutlicher äußerten sich nach den Anschlägen auf der London Bridge u. a. der muslimische Polizeichef Mak Chishty, der bekannte Journalist Sunny Hundal und der Fernsehstar und Talentshow-Juror Piers Morgan. Die für ihre Ausfälle u. a. gegenüber Migranten, Minderheiten und Muslimen bekannte Radiomoderatorin und Kolumnistin Katie Hopkins twitterte unmittelbar nach dem Anschlag von Manchester hasserfüllt, es sei Zeit für eine „Endlösung der Muslimfrage“. Dafür wurde sie von LBC Radio zwar entlassen, nach dem Anschlag auf der London Bridge legte Hopkins im US-Fernsehkanal Fox News aber noch einmal nach und forderte die Einrichtung von Internierungslagern in Großbritannien.
Bei aller Kritik und routinemäßigen Aufrufen zu mehr Engagement bleibt unberücksichtigt, dass Großbritanniens Muslime die jüngste Terrorserie einstimmig verurteilt haben. Der Muslim Council of Britain, die landesweit größte muslimische Basisorganisation, nannte die Attentäter „Feiglinge“. Jeder vernünftige Muslim könne auf solche Taten nur „entsetzt und angeekelt“ reagieren. Londons Bürgermeister Sadiq Khan, selbst Muslim, zeigte sich nicht nur persönlich bestürzt. Er verurteile die unbeschreiblichen Gewaltakte der Terroristen, die von sich behaupteten, sich zum selben Glauben wie er zu bekennen, sagte Khan.
Mehr als 130 britische Imame verweigerten den Attentätern der London Bridge das rituelle Totengebet. Ein unerhörter Akt, der eigentlich nur als klare Anerkennung der muslimischen Verantwortung gedeutet werden kann.
Nachdem er am Tatort Blumen niedergelegt hatte, verkündete ein Sprecher: „Wir werden das rituelle Totengebet für die Täter nicht verrichten und rufen auch andere Imame und religiöse Autoritäten dringend dazu auf, ihnen dieses Privileg nicht zuteilwerden zu lassen. Solche unentschuldbaren Taten stehen im völligen Widerspruch zu den erhabenen Lehren des Islams.“
Etwa zur selben Zeit wurde bekannt, dass britische Muslime einige der Drahtzieher des Anschlags von Manchester wegen deren extremistischer Gesinnung bereits lange vor der schrecklichen Tat den Behörden gemeldet hatten. Ob unmittelbar nach einem Attentat, wenn die Emotionen in Politik und Öffentlichkeit hochschlagen, oder im täglichen Leben: Britische Muslime wollen „mehr tun“, und sind bereit, sich unangenehmen Fragen zu stellen.
In der Regierung May ist das Interesse an Gesprächen mit Muslimen offenbar deutlich geringer, vor allem bei den Mitgliedern, die das umfassende Scheitern der britischen Anti-Terror-Strategie zu verantworten haben.
Tatsächlich bemüht sich die Premierministerin seit ihrer „Genug ist genug“-Rede, die öffentliche Aufmerksamkeit von ihren Plänen zur Extremismusbekämpfung auf die muslimische Gemeinde zu lenken. Gleichzeitig forderte sie, Internetdienstanbieter und soziale Medien in die Pflicht zu nehmen. Auch die Verschlüsselung mobiler Daten und Menschenrechtsnormen müssten auf den Prüfstein gestellt werden. Dazu wurde über die Notwendigkeit neuer Gesetze diskutiert, obwohl in Großbritannien seit 2001 bereits über 100 Gesetzesinitiativen zur Terrorismusbekämpfung verabschiedet wurden.
Notwendig wäre stattdessen wäre ein radikales Umdenken in der Extremismusbekämpfung. Das 2005 eingeführte „Präventions“-Konzept wurde wiederholt aus den Reihen der muslimischen Gemeinschaft, aber auch von politischer und wissenschaftlicher Seite kritisiert. Es fördere u. a. Bespitzelung, ethnisches Profiling und schränke die Bürgerrechte ein.
Auf die Abschaffungsforderungen haben Regierungsvertreter bislang mit variierenden Anpassungsvorschlägen reagiert. Die einen plädieren für kleine Optimierungen, bspw. eine bloße Namensänderung. Statt „Prevent“ solle das Konzept „Engage“ heißen. Eine zweite Gruppe, zu der auch Premierministerin May gehört, fordert seine weitere Stärkung und striktere Anwendung. Vor weniger als zwei Jahren, damals Innenministerin der Regierung Cameron, hatte May auf die Notwendigkeit einer umfassenden Überprüfung öffentlicher Einrichtungen auf mögliche extremistische Unterwanderung hingewiesen. Eine Untersuchungskommission sollte sich nach ihrem Willen mit (der Bedeutung) der Scharia in Großbritannien befassen. May forderte außerdem, Moscheen und andere Räumlichkeiten, die im Verdacht stünden, Extremismus zu fördern, schließen zu lassen. Extremisten und Extremismussympathisanten sollten elektronische Fußfesseln tragen. Zudem müsse gesetzliche Reichweite ausgedehnt werden, um auch nicht gewaltbereiten Extremismus besser bekämpfen zu können. Es solle, so May, keine „staatsfreien Räume“ geben.
Schwer tut sich die Politik hingegen damit, die hemmungslose Islamophobie anzuerkennen, die sich seit mehr als einem Jahrzehnt nicht nur in der Öffentlichkeit sondern auch im politischen Raum ausbreiten konnte. Ultrarechte Gruppierungen wie die English Defense League und Britain First konnten in den letzten Jahren ungehindert einen immer aggressiveren Ton gegenüber Muslimen anschlagen. Betrachtet man Kommentare wie die von Katie Hopkins und ihresgleichen, gilt die Forderung der Regierung May, keine staatsfreien Räume für Extremisten mehr zuzulassen, offenbar nicht für Islamophobe. Im Gegenteil. Anti-muslimische Extremisten durften ihrem Hass bei viel zu vielen Gelegenheiten freien Lauf lassen.
Statt neuer Gesetze und einer noch härteren Politik wäre eine Strategie nötig, in der Großbritanniens Muslime als Partner, nicht als Feinde betrachtet werden, die auf bereits Erreichtem aufbaut, und die auf Zusammenarbeit mit der muslimischen Gemeinschaft setzt. Zugleich muss sich der Ton in den öffentlichen und politischen Debatten gegenüber Muslimen und dem Islam ändern. Dass das Fundament dazu bereits geschaffen ist, zeigte sich nicht zuletzt in der Bestürzung und Abscheu britischer Muslime über die Anschläge und ihrer Weigerung, das Totengebet für die Täter zu verrichten.
Ob das auch der Regierung May klar ist, bleibt offen. Wenn Großbritannien seine Strategie zur Extremismusbekämpfung effektiver und damit das Land letztlich sicherer machen wollen, müssen die Schuldzuweisungen aufhören. Die politisch Mächtigen müssen anerkennen, dass auch sie zur Zusammenarbeit verpflichtet sind, um Lösungen nicht nur für Extremismus, sondern auch für Islamophobie zu finden. Um diesen Prozess anzustoßen, müssen auch sie sich den schwierigen Gesprächen stellen, die sie viel zu lange vermieden haben.