







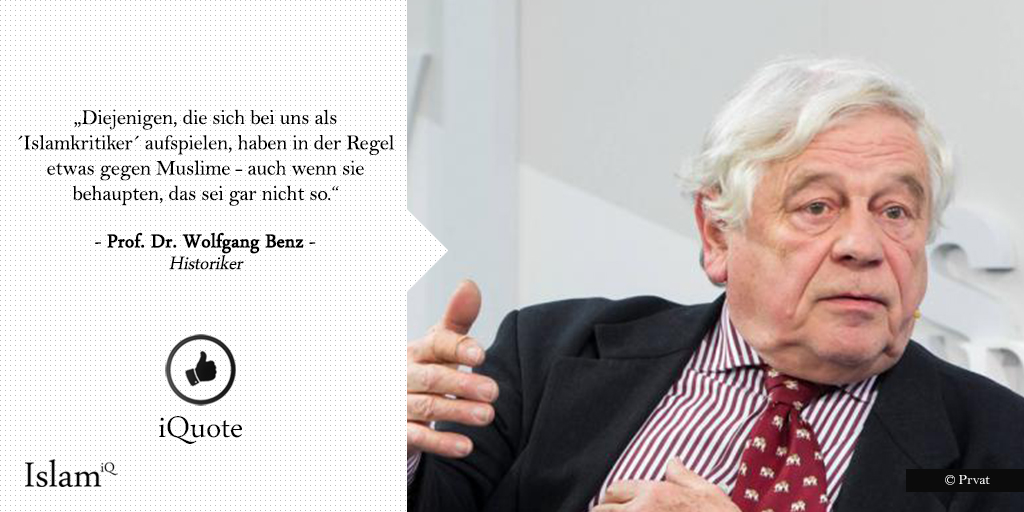

Rechtsextreme in Europa berufen sich oft auf christliche Werte. Dabei zeigt eine neue Studie: Islamfeindliche Vorurteile gehen vor allem auf autoritäre, nationalistisch gefärbte Einstellungen zurück.

Islamfeindliche Einstellungen in Westeuropa haben deutlich weniger mit persönlichem Glauben zu tun, als oft angenommen wird. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue politikwissenschaftliche Studie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU), veröffentlicht in Research & Politics. Politikwissenschaftler Kai Arzheimer zeigt darin, dass antimuslimische Vorurteile vor allem mit nativistischen und autoritären Haltungen verknüpft sind – nicht jedoch mit christlicher Religiosität.
Für die Untersuchung wertete Arzheimer Daten von knapp 75.000 Personen aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden aus. Die Erhebung entstand im Rahmen des internationalen SCoRE-Projekts, das politische Einstellungen und Radikalisierung in Europa analysiert. Grundlage war ein besonders detaillierter Fragebogen, der zentrale Dimensionen rechtspopulistischer und rechtsextremer Weltbilder erfasste, darunter Nativismus, Populismus und autoritäre Orientierung.
Im Fokus standen ausschließlich Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der vier Länder. Personen anderer Religionszugehörigkeit als dem Christentum wurden nicht betrachtet; Menschen ohne religiösen Glauben hingegen schon. Die Analyse verband fünf Faktoren: christliche Religiosität, Nativismus, Islamfeindlichkeit, autoritäre Einstellungen und Populismus.
Der Befund fällt eindeutig aus: Der Zusammenhang zwischen persönlicher Religiosität und islamfeindlichen Einstellungen sei „praktisch gleich null“, so Arzheimer. Wer regelmäßig in die Kirche gehe, sei nicht stärker islamfeindlich eingestellt als nicht religiöse Menschen. Signifikant seien hingegen die Verknüpfungen zwischen islamfeindlichen Vorurteilen, Fremdenfeindlichkeit und autoritären Haltungen – in allen vier Ländern gleichermaßen.
Die Ergebnisse erklären aus Sicht des Forschers, warum rechtspopulistische Parteien häufig auf eine vermeintliche Verteidigung „christlicher Werte“ setzen. Diese Strategie, in der Forschung als „Christianismus“ beschrieben, nutze christliche Identität primär als kulturelles Abgrenzungsmerkmal. Damit erreichten rechte Akteure auch säkulare Wählerschichten, die empfänglich für nationalistische und migrationskritische Botschaften sind.
Zugleich zeigt die Studie Unterschiede zu den USA auf: Während dort Teile des weißen Christentums eng mit rechtsextremen Positionen verwoben seien, fehle ein solcher religiöser Nährboden in Westeuropa. Ob christianistische Narrative im zunehmend säkularen Umfeld dauerhaft Erfolg haben, bleibe offen.