







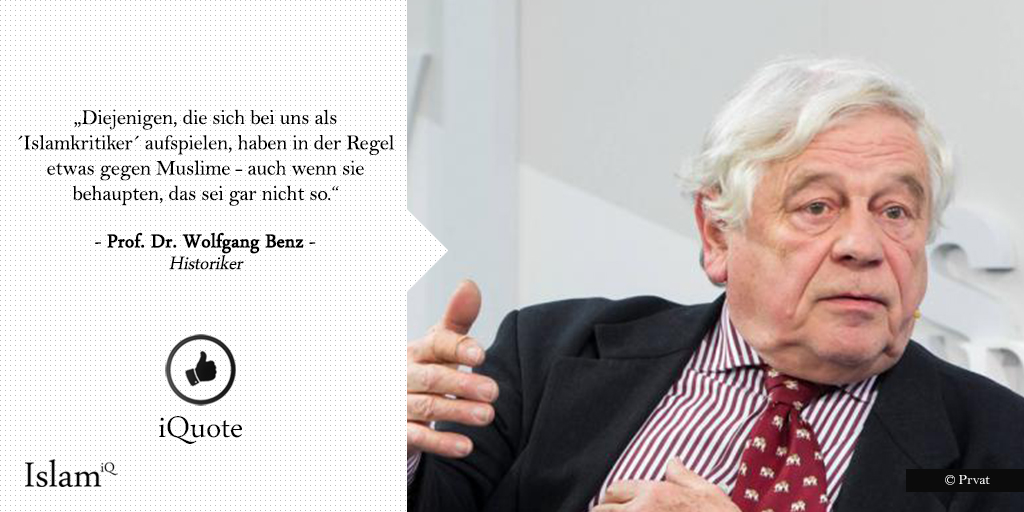

Ex-Bedienstete berichten von alltäglichem Rassismus und Schikanen in der JVA Weiterstadt. Wer Kritik übt, gerät unter Druck. Das Ministerium weist die Vorwürfe zurück.

In der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) sollen rassistische Beleidigungen, gezielte Schikanen und feindselige Personalstrukturen jahrelang zum Alltag gehört haben. Das berichten ehemalige Beschäftigte, die sich gegenüber dem „hr“ geäußert haben. Ihre Aussagen umfassen Beobachtungszeiträume zwischen 2010 und 2025 und betreffen teilweise auch Vollzugseinrichtungen in Frankfurt. Die Justiz weist die Anschuldigungen zurück – doch die Vielzahl der übereinstimmenden Schilderungen lässt Zweifel an der Darstellung der Behörden offen.
Mehrere Ex-Beamte, die anonym bleiben müssen, sprechen von einem Klima, in dem rassistische Sprache und Demütigungen geduldet, mitunter sogar gefördert worden seien. „Rassismus gehört zum guten Ton und wird offen und subtil täglich gelebt“, berichtet eine ehemalige Bedienstete. Gefangene mit Migrationsgeschichte seien regelmäßig als „Kakerlaken“ bezeichnet worden. Wer sich diesem Umgang verweigert oder Kritik äußerte, sei anschließend ausgegrenzt oder systematisch gemobbt worden.
Besonders schwer wiegen Vorwürfe, die sich gegen den internen sogenannten Strukturbeobachter richten – eine Position, die eigentlich Radikalisierung erkennen und verhindern soll. Ein damaliger Mitarbeiter aus Jordanien soll von diesem mit „Kameltreiber“ beschimpft worden sein. Das Ministerium bestätigt den Vorfall und ein eingeleitetes Disziplinarverfahren. Trotz der Ermittlungen war der Beamte wenige Monate später wieder als Strukturbeobachter tätig. Erst im September 2025 ging er in Pension.
Ehemalige Mitarbeitende sprechen von einem System, das nicht nur wegsieht, sondern Kritiker aktiv abstraft. Einseitige Beförderungskulturen und gegenseitige Abhängigkeiten schafften eine Atmosphäre, in der „Ja-Sager weiterkommen und Widerspruchsführende scheitern“. Wer Missstände melde, gelte als Verräter, heißt es.
Das hessische Justizministerium teilt auf Anfrage mit, man gehe Hinweisen grundsätzlich „sehr ernsthaft“ nach. Die „absolute Mehrheit“ der rund 2.000 Mitarbeitenden arbeite pflichtgemäß, einzelne Fälle würden lediglich ein „Fehlverhalten geringer Personen“ widerspiegeln. Für Betroffene von Diskriminierung gebe es inzwischen eine psychologisch betreute Anlaufstelle sowie seit 2023 eine interne Meldestelle für Hinweisgeber. Von dort heißt es allerdings: Bislang sei kein einziger Fall gemeldet worden.
Gerade das bezweifeln ehemalige Vollzugsbeamtinnen: Aus Angst vor Repressalien, schreiben sie, werde kaum jemand ein offizielles Verfahren anstoßen. „Wer etwas meldet, verliert“, sagt eine frühere Kollegin.
Die geschilderten Vorwürfe – Beleidigungen, Ausgrenzung, gezielte Demütigung, systematische Abschreckung von Whistleblowern – zeigen ein Muster, das über einzelne Zwischenfälle hinausgeht. Die Aussagen legen nahe: Rassismus im Vollzug wird nicht nur praktiziert, er wird toleriert und verschleiert.
Während das Ministerium betont, Menschenwürde habe „oberste Priorität“, erzählen ehemalige Angestellte eine Geschichte, in der dieser Anspruch regelmäßig scheitert: „Ich hatte hohe Erwartungen an den Job und an den Rechtsstaat“, sagt eine der Quellen. „Aber irgendwann hat mich nichts mehr schockiert.“
Ob die neuen Beschwerdewege ein Wendepunkt sind oder nur Symbolpolitik – das muss sich zeigen. Bis dahin steht der Verdacht im Raum, dass ein staatliches System, das Schutz, Kontrolle und Rechtsstaatlichkeit gewährleisten soll, selbst strukturelle Diskriminierung zulässt.