




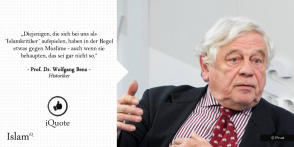
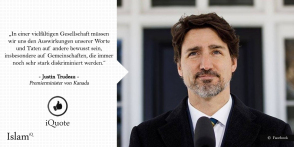

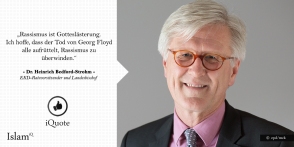

Afghanistan, Türkei, Mali, Kosovo – in vielen Ländern ist die Bundeswehr im Einsatz. Konfrontiert werden die Soldaten dort, aber auch im täglichen Kasernenleben mit unterschiedlichen Kulturen. Seminare sollen den Umgang miteinander erleichtern.
Ein Bild wird an die Wand projiziert. Es zeigt einen afghanischen Bürgermeister, der mit einem Bundeswehr-Soldaten vor die Öffentlichkeit tritt – Hand in Hand. Der deutsche Soldat schaut irritiert, doch anders als hierzulande ist eine solche Geste zwischen Männern in dem zentralasiatischen Land üblich. Es ist ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich Verhaltensweisen sein können. Soldaten spüren das deutlich im Auslandseinsatz. Für sie bietet das Zentrum Innere Führung in Koblenz Seminare in interkultureller Kompetenz an. Ziel ist es, für Fremdes zu sensibilisieren, Berührungsängste zu nehmen, Verständnis zu wecken.
Dieses Mal sind 16 Soldaten aus ganz Deutschland zu dem einwöchigen Kurs gekommen. Einige waren schon im Ausland, anderen steht es bevor. „Es geht darum, andere Denkweisen kennenzulernen“, sagt ein Hauptfeldwebel der Heeresflieger. Ein Soldat brauche heute einfach andere Kompetenzen als während des Kalten Krieges. Wissen über fremde Kulturen könne helfen, Missverständnisse aufzulösen, betont der Mann, der selbst mit einer Brasilianerin verheiratet ist.
Ähnlich sieht das eine Sanitäterin, die auch Hauptfeldwebel ist. „Ich will mir Ideen holen, auch mal anders zu handeln“, sagt sie. Welche Fallen bei interkulturellen Begegnungen lauern können, weiß sie aus Afghanistan. Dort habe sie mal einem einheimischen Mann etwas sagen wollen, gehört habe der auf sie aber nicht – weil sie eine Frau sei. „Damit konnte ich erst gar nicht umgehen.“
Dass das Verhalten des Afghanen nicht persönlich gemeint war, auch darum drehen sich die Seminare, die es seit 2010 gibt. Oft lasse sich anderes Verhalten mit anderer Sozialisation erklären, erklärt Dozent Youssouf Diallo aus dem westafrikanischen Burkina Faso. Während man etwa in Deutschland einem Gesprächspartner in die Augen schaue, sei das in Westafrika unhöflich, Wegsehen signalisiere kein Desinteresse.
Bei Begrüßungen seien dort zuerst Männer dran, dann Frauen. Daraus könne man aber nicht automatisch schließen, dass Frauen weniger Rechte hätten, sagt Diallo. Außerdem hätten die Menschen dort ein anderes Zeitverständnis als Mitteleuropäer. „Deutsche denken: Wir starten um acht Uhr, um zehn sind wir fertig, so funktioniert das dort nicht“, sagt Diallo schmunzelnd. Und noch einen Rat hat er: „Wenn Afrikaner Sie nach ihrer Familie fragen und ob Sie verheiratet sind, dann ist das nicht unbedingt Neugier. Man fragt das einfach.“
Bei Dozentin Ania Szymanska müssen sich die Seminarteilnehmer paarweise gegenüber aufstellen, Schritt für Schritt rücken sie aufeinander zu. „Eine Armlänge, das ist die übliche Entfernung für ein Kennenlern-Gespräch in Deutschland», sagt sie. Als die Paare dicht an dicht stehen, ruft sie: „Jetzt sind wir in Lateinamerika.“ Einige drehen sich von ihrem Gegenüber weg, lächeln etwas verschämt. Lateinamerika scheint in Koblenz dann doch etwas ungewohnt.
Szymanska, deren Eltern aus Bulgarien und Polen kommen, spricht auch Afghanistan an. Dort seien Einheimische anfangs von verspiegelten Sonnenbrillen der Soldaten verwirrt gewesen. Es habe Gerüchte gegeben, dass die Fremden mit den Brillen die Gedanken des Anderen lesen könnten. Vertrauen kann so kaum entstehen. „Es sind oft Kleinigkeiten, die große Wirkung haben“, sagt Szymanska. Das bestätigt auch Stefano Toneatto, Pressestabsoffizier des Zentrums Innere Führung. „Interkulturelle Kompetenz kann in letzter Konsequenz sogar Blut sparen“, sagt er.
Bei dem Seminar geht es nicht nur ums Ausland, wie Kursleiter und Oberstleutnant Martin Jung erklärt. „Den ersten Kontakt mit anderen Kulturen haben Soldaten in der Kaserne mit Kameraden, die einen Migrationshintergrund haben.“ Auch bei der Zusammenarbeit mit Bündnispartnern träfen Kulturen aufeinander. „Nicht nur die Anderen ticken anders, auch wir tun es“, sagt Jung. „Wir bieten beim Seminar ein Buffet an eigenen und fremden kulturellen Gegebenheiten. Jeder kann etwas probieren und mitnehmen.“
Den Islam zum Probieren gibt es bei einem Besuch samt Mittagessen in der Koblenzer Tahir-Moschee. Der dort für interkulturellen Dialog zuständige Waheed Khan erklärt, wie wenig die Gräueltaten des IS in Syrien und im Irak mit den Grundwerten des Koran zu tun haben. „Jeder friedliebende Muslim empfindet dabei Schmerz“, sagt er. Oft werde er bei Begegnungen mit Soldaten mit Stereotypen konfrontiert, etwa dass Frauen im Islam rechtlos seien. Die lösten sich im Gespräch dann auf. Manchmal gehe es um ganz praktische Dinge. „Ein Soldat hat mich mal gefragt, warum in Afghanistan so viele weiße Autos herumfahren.“ Ihm habe er dann geschildert, dass die Farbe dort für Reinheit stehe.(dpa)