







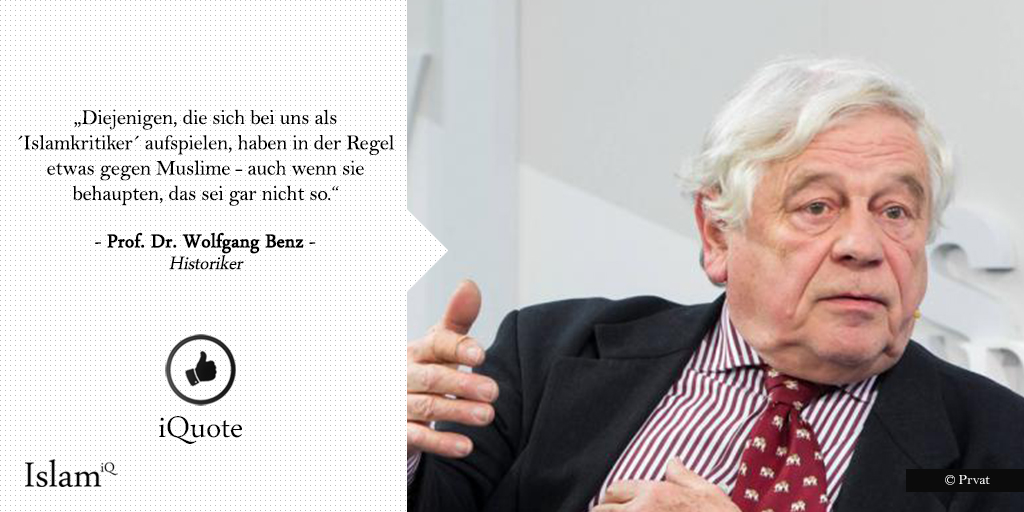

Mit Edward Said hat die Kritik am Orientalismus ihren Anfang genommen. Als Gegenstück hierzu spricht man heute verstärkt von einem Okzidentalismus. Was die beiden Begriffe eint und trennt, erklärt die Heidelberger Islamwissenschaftlerin Susanne Enderwitz.
Im Jahr 1978 erschien Edward Saids Buch „Orientalism“ (Orientalismus), das am Anfang der „Anticolonial“, „Postcolonial“ und „Subaltern“ Studies stand und das theoretische Rüstzeug lieferte, mit dem heute westliche und nichtwestliche Forscher die eigene und die jeweils andere Wahrnehmung von Europäisch-Außereuropäisch, Ost-West, Tradition-Moderne, Orient-Okzident oder Europa-Asien betrachten. Doch Said war keineswegs der erste Forscher, der Kritik an der Weltsicht der Orientalistik übte, die viele Fächer (z. B. Islamwissenschaft, Indologie, Sinologie und selbst noch Teile der Afrikanistik) umfasste, aber immer auf ähnlichen Grundvoraussetzungen, Methoden und Zielsetzungen aufbaute. Schon vor ihm gab es eine Reaktion auf die veränderte geopolitische Situation nach 1945, die mit dem Sieg über den Faschismus dem europäischen Rassismus weitgehend den Boden entzogen hatte, aber auch auf eine Rebellion der nicht-europäischen Welt gegen ihre Kontrolle durch den Westen hinauslief.
Bereits 1963 machte der gebürtige Ägypter Anouar Abd al-Malek in seinem Aufsatz „Orientalism in Crisis“ (Orientalismus in der Krise) den Orientalisten zum Vorwurf, aus einem Araber einen „homo Arabicus“, einem Chinesen einen „homo Sinicus“ und aus einem Afrikaner einen „homo Africanus“ gemacht zu haben. Auf diese Weise hätten sie alle Nicht-Europäer als Sonderformen menschlicher Existenz definiert, um ihnen dann die Europäer als „normale“ Menschen mit einer Geschichte, einer Entwicklung und Fortschritt gegenüberzustellen. Der Begriff „Eurozentrismus“ stand im Raum, also der an die Europäer gerichtete Vorwurf, die ganze Welt nur aus europäischer Perspektive wahrnehmen zu können und zu wollen.
Abd al-Maleks „Eurozentrismus“ ist seiner Definition nach gar nicht weit entfernt von Saids „Orientalismus“ – sie sind wie die beiden Seiten einer Medaille. Während der Begriff „Eurozentrismus“ auf die Operationen abzielt, mit dem sich die Europäer selbst zur Norm erhoben, akzentuiert der Begriff „Orientalismus“ die Konsequenzen, die für die anderen Völker aus dieser Normsetzung erwuchsen. Aber erst Saids Buch gelang es, rund fünfzehn Jahre später als Abd al-Maleks Aufsatz, eine weltweite Diskussion zu entfachen. Warum? Edward Said trat, so könnte man sagen, offene Türen ein. Die Kritik am Vietnamkrieg, die Studentenbewegung, die Entkolonialisierung, der Kalte Krieg und die Bewegung der Blockfreien, all dies und mehr zeigte, dass sich die Wahrnehmungen geändert hatten.
Dieser Prozess einer Wegbewegung von alten autoritären Machtverhältnissen unter Völkern und Nationen, Ethnien und Kulturen sowie auch im Innern der Gesellschaften schlugen sich auch in der Wissenschaft nieder, in Fächern wie der Islamwissenschaft zunächst vielleicht weniger als in den „Meinungsführern“ wie Geschichtswissenschaft oder Politologie, wo Forscher seit den sechziger Jahren historisch kontextualisierende, ent-essentialisierende und anti-autoritäre Konzepte und Argumentationsweisen entwickelten.
Nach dem Sechstagekrieg von 1967 begann man dann auch in der Orientalistik die Grundsatzfrage zu stellen, ob die Philologie, das Mittelalter und die Religion noch ausreichen konnten, die lebendige Realität des Orients angemessen beschreiben und verstehen könnten. 1973 kam man auf dem Internationalen Orientalistenkongress in Paris überein, die akademische Fachbezeichnung „Orientalistik“ selbst in Frage zu stellen und sie durch die Wendung „Human Sciences in Asia and North-Africa“ (Geisteswissenschaften Asiens und Nord-Afrikas) zu ersetzen. Das dichotomische Weltbild eines „Wir“ in Europa und inzwischen auch Amerika gegenüber einem von Nordafrika bis nach China reichenden „Nicht-Wir“ schien dann doch zu simpel gestrickt, um in einer differenzierten und sich gleichzeitig globalisierenden Welt noch für irgendeine Welterklärung taugen zu können. Eine jüngere Generation von Wissenschaftlern trat an, auf den z. T. neu geschaffenen Lehrstühlen ein Orientbild zu vermitteln, das sie nicht mehr nur aus Texten bezogen und das den Kolonialismus, die Moderne und die Gegenwart auch nicht mehr aussparte.
Edward Saids „Orientalismus“ lag also durchaus im Trend und wurde zum Kultbuch, das die Diskussion in allen orientalistischen Fächern dominierte. Aber es gab auch Kritik an Saids Thesen, die an den Grundfesten seiner Argumentation rüttelte, allerdings ließ sie in Amerika und Europa noch Jahre auf sich warten. Viel früher meldete sich der aus Syrien gebürtige Ğalāl Ṣādiq al-‘Aẓm zu Wort, der 1981 auf Arabisch und 1984 auf Englisch das Thema „Orientalism and Orientalism in Reverse“ (Orientalismus und Orientalismus unter umgekehrtem Vorzeichen) aufgriff. Er bezog sich auf Saids Definition des Orientalismus als “a Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient”. Diese Definition geht von einer bewussten Inszenierung des Bildes aus, das sich der Okzident von einem statischen, irrationalen und verweichlichten Orient machte, um ihn in der Folge als Gegenbild seiner selbst auch in der Realität ohne Schuldbewusstsein seiner Domination unterwerfen zu können. So weit, so gut und auch in Übereinstimmung von Abd al-Maleks Gedanken.
Aber Said geht noch weiter: Orientalismus ist für ihn in Anschluss an Michel Foucault ein Diskurs, wobei dieser Diskurs als Resultat einer Interaktion von Wissen und Macht erscheint, die in einem endlosen Zirkel miteinander verbunden sind. Dass es seit Homer vornehmlich die Idee des Westens vom Orient gewesen sein sollte, die das Orientbild des Westens schuf, und dass ebenfalls seit Homer alle Beschäftigung des Westens mit dem Orient nur der Idee gedient haben sollte, ihn als Gegenbild des Westens zu konstruieren, um diese beiden Ideen dann im Kolonialismus Wirklichkeit werden zu lassen, brachte Ğalāl Ṣādiq al-‘Aẓm dazu, Said selbst eines „Orientalismus“ zu bezichtigen.
Er meinte damit, dass auch Said ent-historisierend und essentialisierend argumentiert, indem er nicht etwa von rivalisierenden Interessen verschiedener Reiche im Zeitalter der Imperien spricht, bei denen die Grenzlinien auch keineswegs immer so klar zwischen Orient und Okzident verliefen, sondern von einer ontologischen Differenz zwischen Ost und West (orientalism). Damit befördere Said ein Denken unter Nationalisten, Asianisten oder Islamisten im Orient selbst, die diese ontologische Differenz zwischen Ost und West dankbar aufgriffen, um sie für ihre eigenen Zwecke einer fast manichäischen Zweiteilung der Welt ins Positive zu übersetzen (orientalism in reverse).
Was aber die Realität hinter dem Fremd- oder Selbstbild des Orients sein könne, war die Frage, die in späteren Jahren immer differenzierter an den Said’schen Text herangetragen wurde. Erstens ist der Orient bei Said vor allem arabischer und islamischer Orient, weder indischer, japanischer und chinesischer noch hinduistischer, buddhistischer oder konfuzianischer Orient. Zweitens steht sehr wohl in Frage, ob die Europäer tatsächlich über zwei Jahrtausende hinweg so sehr auf die Araber, Perser und Osmanen/Türken fixiert waren, dass sie ihre Selbstfindung im Wechsel von Scholastik, Renaissance, Reformation, Gegenreformation, Aufklärung und Moderne nicht auch an der Auseinandersetzung mit ihren eigenen früheren und/oder unterschiedlichen Identitäten herausgebildet hätten. Drittens darf man wohl nicht übersehen, dass über Jahrhunderte hinweg als Erz-Gegenfigur des Europäers für diesen nicht der Araber oder Muslim, sondern vielmehr der Jude in Erscheinung trat. Viertens sähe die Beschäftigung mit dem Orientalismus ganz anders aus, wenn Said sich nicht auf die Briten und Franzosen beschränkt hätte, sondern auch die Holländer, Spanier, Italiener, Russen und Deutsche in seine Untersuchung mit einbezogen hätte. Und fünftens sei die Vorstellung absurd, wie der reale Okzident sich einen realen Orient habe unterwerfen können, wenn er doch nur erfundene Vorstellungen von ihm gehabt habe.
Trotz der Widersprüche, manchmal aufgrund der Widersprüche und jedenfalls durch die Widersprüche hindurch erwies sich die Arbeit Saids als eine anregende Lektüre. Im vergangenen Jahrzehnt allerdings wurde es ruhiger um „Orientalismus“, und es scheint, dass dazu inzwischen das meiste gesagt worden sei, was sich überhaupt sagen lässt. Außerdem begann im Westen wie im Osten ein anderer Begriff die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, der andere und vielleicht mehr Erkenntnisse versprach – nämlich „Okzidentalismus“.
Wer die Ehre für sich in Anspruch nehmen darf, diesen Begriff erfunden zu haben, ist nicht mehr zu ermitteln. Ian Buruma und Avishai Margalit, die im Jahr 2005 “Occidentalism. The West in the Eyes of Its Enemies” (Okzidentalismus. Der Westen in den Augen seiner Feinde) veröffentlichten, reklamieren die Wortprägung für sich. In Anlehnung an Saids „Orientalismus“ wollten sie damit eine Geisteshaltung zum Ausdruck bringen, die den Westen mit Stereotypen belegt, das Fremde an ihm akzentuiert und mit Abneigung auflädt. „Okzidentalismus“ als die Idee einer „Okzidentalistik“, die als Gegenstück zur Orientalistik den Westen insgesamt zum Gegenstand macht, geht allerdings schon bis in die fünfziger Jahre zurück und soll zum ersten Mal von Muḥammad Rahbār beim Internationalen Islamischen Kolloquium 1957/8 in Lahore formuliert worden sein. Said selbst nahm später die Idee eines östlichen Gegenstücks zur Orientalistik auf, allerdings nur, um sie sogleich wieder zu verwerfen: „Above all, I hope to have shown to my reader that the answer to Orientalism is not Occidentalism“, so steht es am Ende seines Buches.
In allen drei Beispielen ist – unterschiedlich positiv oder negativ konnotiert – Okzidentalismus ein Orientalismus unter umgekehrten Vorzeichen, nämlich die Idee, die man sich im Orient vom Okzident macht. In seinem viel besprochenen Aufsatz „Occidentalism: The World Turned Upside-down“ (Okzidentalismus: Die auf den Kopf gestellte Welt) brachte James Carrier 1992 jedoch eine ganz andere Bedeutung von Okzidentalismus ins Spiel: das Bild, das sich der Okzident von sich selbst macht. Als Ethnologe war ihm aufgefallen, dass westliche Forscher fremde Gesellschaften untersuchen, ohne sich bei ihren Studien jemals Rechenschaft über das Bild abzulegen, das sie – gewissermaßen naturwüchsig und unreflektiert – von ihrer eigenen Gesellschaft haben. Ihm kam es darauf an, die Dialektik von Okzidentalismus und Orientalismus zu zeigen, und er unterschied vier verschiedene Aspekte dieser Dialektik: 1) Orientalismus, die Vorstellung, die „wir“ uns von „anderen“ machen, 2) Ethno-Orientalismus, die Vorstellung, die „andere“ sich auf dem Hintergrund „unseres“ Bildes von ihnen von sich selbst machen, 3) Ethno-Okzidentalismus, die Vorstellung, die „andere“ sich auf dem Hintergrund ihres Selbstbildes von „uns“ machen, und 4) Okzidentalismus, die Vorstellung, die „wir“ uns von uns selbst machen.
Aus der Perspektive des Westens gesprochen, liegt der Witz von Carriers Überlegungen darin, dass Okzidentalismus – das selbstreferentielle Bild des Westens, nicht sein stereotypisiertes Bild im Osten – immer schon als „stiller Teilhaber“ des Orientalismus vorhanden gewesen sei und dass die beiden Bilder einander gegenseitig bedingten. Okzidentalismus ist also, in den Worten von Fernando Coronil, der 1996 die Überlegungen von Carrier aufgriff, „not the reverse of Orientalism but its condition of possibility, its dark side (as in a mirror).“ Wir bleiben damit gewissermaßen auf Edward Saids Linie, nur dass aus „Orientalismus“ „Okzidentalismus“ wird.
An den Ausführungen von Carrier und Coronil ist, bei gestiegener Komplexität, dreierlei bemerkenswert. Die Dialektik von „eigen“ und „fremd“ im Carrier’schen Sinn impliziert, dass sie keine Prärogative des Westens ist. Dass auch Said diesen Umstand gewürdigt hatte, fiel schon al-‚Aẓm auf. Tatsächlich heisst es bereits ziemlich zu Anfang von „Orientalism“, dass die essentialistische Definition des jeweils anderen eine allgemeine Operation sei, „by which a set of people seeks to intensify its own sense of itself by dramatizing the distance and difference between what is closer to it and what is far away“.
Die Frage ist also, so die zweite Erkenntnis von Carrier, nicht der Ethnozentrismus an sich, sondern der Umfang und die Qualität, die dieser annimmt. Die Definition des „anderen“ umfasst umso mehr Menschen, Sitten oder Gebräuche, je enger wir „uns“ in unserer eigenen Definition fassen, und umgekehrt. Am einen Ende des Spektrums umfasst das „wir“ die gesamte Menschheit, so wie die Anthropologin Margaret Mead Melanesien als eine Art natürliches Laboratorium betrachtete, in dem alle menschenmöglichen Verhaltensweisen vorhanden waren und studiert werden konnten. Am anderen Ende des Spektrums, wo das „wir“ extrem restriktiv definiert wird, dehnt sich das „sie“ auf fast die gesamte Welt aus und verfährt nach dem Sprichwort: „Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht“.
Aus dieser letzten Beobachtung Carriers folgt seine dritte Erkenntnis, die Qualität von Orientalismus und Okzidentalismus betreffend. Die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Orient und Okzident folgt nämlich keineswegs einer Symmetrie, aber der Unterschied ist nur historisch und nicht essentialistisch zu verstehen. Bernhard Lewis stellte seinerzeit fest, dass im 17. Jh., dem Jahrhundert, in dem die europäische Expansion begann, das Interesse Europas am Orient (und damit die Ausformulierung des „Orientalismus“) weit größer war als umgekehrt.
Dieser Orientalismus, wie Said ihn vor allem im Blick hat, war eben mit der Entfaltung globaler Macht verbunden und wurde dadurch fähig, Hierarchien zu etablieren. So sah es auch Samir Amin, der den Eurozentrismus (Orientalismus, Okzidentalismus) an die Entfaltung des Kapitalismus knüpfte und schrieb: „Eurocentrism is thus not a banal ethnocentrism testifying simply to the limited horizons beyond which no people on this planet has truly been able to go. Eurocentrism is a specifically modern phenomenon, the roots of which go back only to the Renaissance, a phenomenon that did not flourish until the nineteenth century. In this sense, it constitutes one dimension of the culture and ideology of the modern capitalist world.” Nicht in systematischer, wohl aber in historischer Perspektive wurde also das Bild des Westens vom Orient wirkungsmächtiger als umgekehrt.
Der Eurozentrismus oder Orientalismus der Moderne, auf Expansion angelegt, konstruierte sich in der Tat den Orient als sein Gegenteil: traditionell, rückständig, anti-modern, und vermochte dieses Bild sogar dem Orient von sich selbst zu vermitteln. Das Resultat waren Ethno-Orientalismus und Ethno-Okzidentalismus als Reaktionsweise derjenigen, die sich im Prozess der Geschichte und damit auch im Prozess der Definitionen als Unterlegene fühlen mussten. Dass heute durch die Etablierung einer „Okzidentalistik“ auf Seiten der früheren kolonisierten Völker, wie sie etwa dem gebürtigen Ägypter Ḥasan Ḥanafī vorschwebt, für einen Rachefeldzug, eine Vergeltung oder auch nur Entschädigung für erlittenes koloniales Leid sorgen könnte, steht indes nicht zu erwarten.
Eine postkoloniale Interpretation von Orient und Okzident kann sich nicht nur zeitlich „nach“ dem Kolonialismus positionieren, sondern muss auch epistemisch über ihn hinaus gehen, indem sie zentrale Annahmen des kolonialen Diskurses dekonstruiert und verabschiedet. Die dichotomische Weltsicht von „wir“ und „sie“ wurde bereits von Frantz Fanon als Fiktion identifiziert und ist einer Perspektive gewichen, die stärker auf die Hybridität von Identitäten achtet, auch der Hybriditäten Europas im Zuge seiner ehemaligen Weltherrschaft. Die Aufmerksamkeit für die Wechselwirkungen der kolonialen, postkolonialen und neokolonialen Begegnung ist ein wichtiger Impuls, den eine Analyse der „geteilten Geschichte“ in globalisierten Zeiten aufnehmen kann, nachdem sich die Bipolarität der Welt seit 1989 ohnehin erledigt hat.