







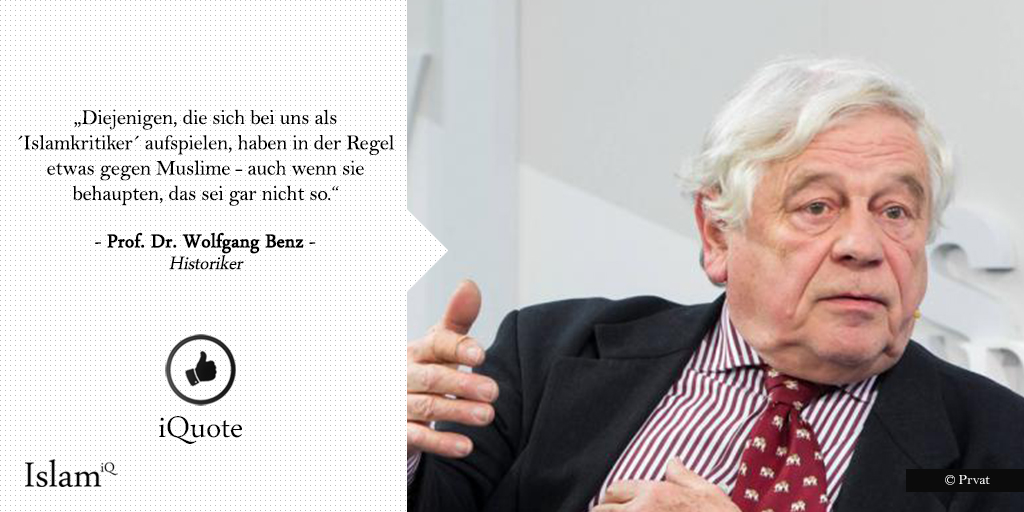

Eine Studie des Forschungsverbunds Deradikalisierung rückt muslimische Jugendliche als Konfliktfaktor in den Fokus – dabei sind die Ursachen vielschichtiger. Ein Kommentar von Dr. Hakan Aydın.

Die jüngst veröffentlichte Untersuchung des Forschungsverbund Deradikalisierung über die Einschätzungen von Lehrkräften und Schulsozialarbeitern zu religiös motivierten Konflikten an Schulen verdient eine genauere Betrachtung. Zwar ist es zu begrüßen, dass das Thema aufgegriffen wird, jedoch weist die Studie mehrere Schwächen auf.
Erstens fällt auf, dass muslimische Schüler in der Darstellung häufig vor allem als Auslöser bestimmter Spannungen erscheinen. Dadurch verschiebt sich der Blick auf einseitige Defizite. Kaum berücksichtigt wird hingegen, dass diese Jugendlichen in vielen Fällen selbst Erfahrungen mit Vorurteilen, Diskriminierung und Ausgrenzung machen. Wer Konflikte verstehen und konstruktiv bearbeiten möchte, muss die Wechselwirkungen zwischen allen beteiligten Seiten in den Blick nehmen.
Zweitens bleibt die Analyse der Ursachen oberflächlich. Religiös aufgeladene Spannungen entstehen nicht isoliert. Familiäre Prägungen, gesellschaftliche Marginalisierung, Benachteiligung im Bildungssystem sowie der Einfluss von Medien und sozialen Netzwerken sind entscheidende Faktoren. Diese Aspekte werden in der Studie nur am Rande behandelt, was das Gesamtbild verzerrt.
Drittens entsteht durch die Fokussierung insgesamt der Eindruck, als seien muslimische Jugendliche in besonderem Maße konfliktanfällig. Angesichts ihrer Minderheitenposition birgt eine solche Darstellung das Risiko von Stigmatisierungen. Pädagogische Arbeit sollte jedoch auf Inklusion, Chancengerechtigkeit und die Stärkung einer positiven Identitätsentwicklung ausgerichtet sein.
Ein Vergleich mit der Forschung von Aydın–Temel („Identity, Faith and Resilience“) verdeutlicht diese Leerstelle: Dort wird gezeigt, dass muslimische Religionslehrer häufig mit Misstrauen, einer ungleichen Behandlung im Vergleich zu anderen Religionsunterrichten sowie institutionellen Hürden konfrontiert sind.
Religiöse Bildung ist zwar verfassungsrechtlich garantiert, doch islamische Religionsgemeinschaften werden beim islamischen Religionsunterricht in Schulen oftmals ausgeschlossen oder erhalten nur begrenzte Möglichkeiten. Dies zeigt, dass zwischen den beteiligten Parteien bislang kein ausreichendes Vertrauen besteht. Gleichzeitig betonen die Befragten, dass sie selbstkritisch mit innergemeindlichen Herausforderungen umgehen und Religion als Ressource für Integration, Resilienz und gesellschaftlichen Beitrag verstehen. Diese ausgewogene Perspektive findet sich in der Studie kaum.
Für einen zukunftsorientierten Umgang mit religiös motivierten Spannungen braucht es mehrere ineinandergreifende Schritte. Zunächst erscheint es notwendig, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Schulen und islamischen Religionsgemeinschaften zu intensivieren, da gerade fehlendes Vertrauen und institutionelle Hürden wiederholt als Problem benannt werden. Eine engere Kooperation könnte hier zu mehr gegenseitigem Verständnis beitragen.
Ebenso bedeutsam ist die Anerkennung der kulturellen und religiösen Hintergründe der Schülerinnen und Schüler. Viele berichten davon, dass ihre Bezüge kaum berücksichtigt werden, was wiederum zu Gefühlen der Ausgrenzung führen kann. Werden diese Dimensionen stärker gewürdigt, fühlen sich Jugendliche mit ihrer gesamten Identität respektiert. Darüber hinaus gilt es, das Heimatgefühl in Deutschland zu stärken. Religion kann Jugendlichen eine wichtige Ressource sein, um Resilienz aufzubauen und sich gesellschaftlich zu verorten; dieser Prozess gelingt jedoch nur in enger Einbindung der Familien.
Auch die Vielfalt innerhalb der muslimischen Gemeinschaften und die kulturellen Unterschiede sollten nicht allein als Herausforderung gesehen werden. Sie können ebenso als Ressource verstanden und vermittelt werden, ohne auf die Vorstellung einer einheitlichen Leitkultur fixiert zu bleiben. Schließlich ist die Qualifizierung der Lehrkräfte ein entscheidender Faktor. Pädagogische Fachkräfte benötigen vertiefte Fortbildungen im Bereich interkultureller und interreligiöser Kompetenz, damit sie sensibel auf Konflikte reagieren können, ohne bestimmte Gruppen durch pauschale Zuschreibungen zu belasten.
Die Studie greift ein relevantes Thema auf, bleibt jedoch in ihrer Analyse und Differenzierung hinter den Erwartungen zurück. So werden zentrale Rahmenbedingungen, unter denen religiös motivierte Konflikte entstehen, nur begrenzt berücksichtigt; auch Erfahrungen von Diskriminierung werden eher randständig behandelt. Zudem steht Religion vielfach in einem problemorientierten Zusammenhang, während ihr Potenzial für Identität, Resilienz und gesellschaftlichen Zusammenhalt weniger in den Blick gerät. Für einen konstruktiven Umgang mit religiös motivierten Konflikten wäre es daher wichtig, eine breitere Perspektive einzunehmen, die sowohl Herausforderungen als auch Ressourcen sichtbar macht.