







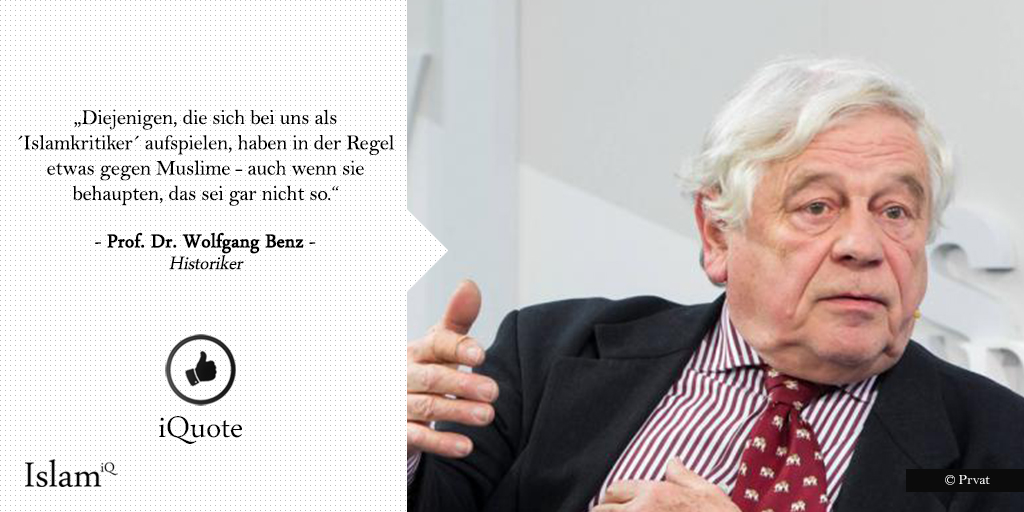

Merz zeigt sich in der „Stadtbild“-Debatte selbstkritisch – doch seine Rücknahme wirkt eher wie Schadensbegrenzung als echte Einsicht.

Wochenlang hatte die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ausgelöste Debatte über das angeblich problematische „Stadtbild“ in Deutschland hohe Wellen geschlagen. Nun räumt Merz ein, seine Wortwahl sei vielleicht „nicht ganz glücklich“ gewesen – ein Eingeständnis, das weniger wie echte Selbstreflexion wirkt als wie ein spät formulierter Versuch, die eskalierte Diskussion wieder einzufangen.
In der ARD-Sendung „Arena“ sagte Merz, er hätte früher erläutern müssen, was er „konkret“ gemeint habe. Doch seine erneute Erklärung bleibt vage und reproduziert einmal mehr die vertraute Alarmrhetorik: Es gebe Städte, die „völlig verwahrlosen“ – ein drastisches Bild, das Merz erneut in direkten Zusammenhang mit Migration setzt. Die Verantwortung für die Zuspitzung der Debatte schiebt er damit zwar rhetorisch von sich weg, hält aber inhaltlich an denselben Verknüpfungen fest.
Gleichzeitig betont der Kanzler, Deutschland sei auf Migration angewiesen – besonders im Pflege- und Gesundheitsbereich. Dieser Hinweis, sachlich richtig, wirkt im Kontext wie ein spätes Gegengewicht zu seiner vorherigen Zuspitzung. Merz präsentiert beides als zwei Seiten einer „Antwort“, vermeidet jedoch, Verantwortung für die stigmatisierende Wirkung seiner ursprünglichen Formulierungen zu übernehmen. Dass er sagt, „jeder, der es gutwillig versucht hat, zu verstehen“, habe ihn ohnehin richtig verstanden, verschiebt die Verantwortung zusätzlich auf das Publikum.
Auch sein erneutes Insistieren auf „Regeln“ und konsequente „Rückführungen“ folgt gewohnt scharfen Linien, die eher politischer Profilierung als inhaltlicher Klärung dienen. Konkrete Daten oder differenzierte Analysen bleiben aus – stattdessen arbeitet Merz weiterhin mit Bildern, die Ängste mobilisieren und gesellschaftliche Gruppen gegeneinander in Stellung bringen.
Die Debatte war im Oktober eskaliert, als Merz das „Problem“ im „Stadtbild“ mit Rückführungen verknüpfte und später – auf Nachfrage – vage auf „Ihre Töchter“ verwies, als könne er damit die problematische Aussage elegant erklären. Seine nachträgliche Präzisierung, gemeint seien Migranten ohne Aufenthaltsstatus, die nicht arbeiteten und sich nicht an Regeln hielten, konnte den Eindruck einer pauschalisierenden und unklaren Schuldzuweisung nicht mehr einfangen.
Mit seiner jetzigen „Selbstkritik“ versucht Merz, den Ton abzumildern, ohne seine grundsätzliche Erzählung in Frage zu stellen. Der zentrale Vorwurf bleibt bestehen: Er hat bewusst mit diffusen Bildern und Andeutungen gearbeitet – und die Konsequenzen davon erst dann relativiert, als der öffentliche Druck zu groß wurde. (dpa/iQ)