







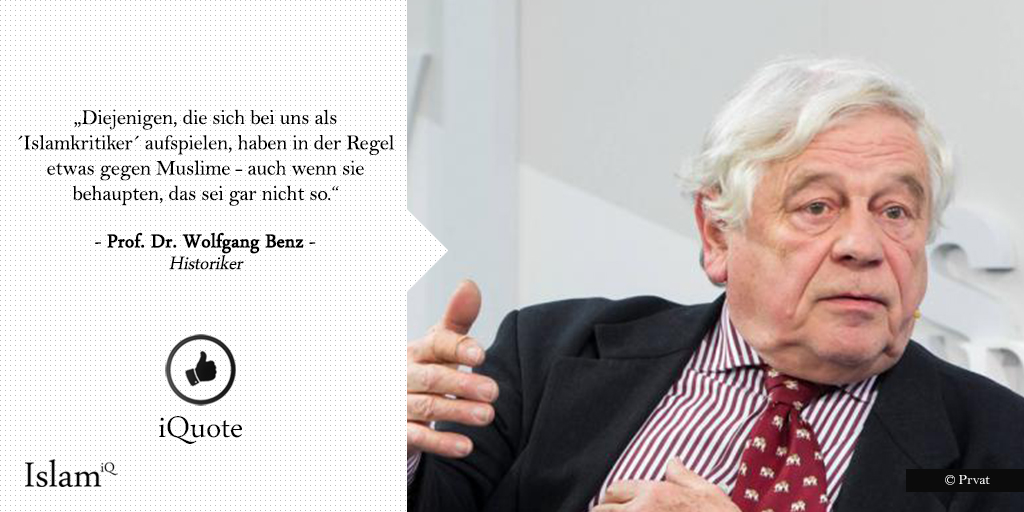

In einer Zeit, in der muslimische Flüchtlinge entmenschlicht werden, erinnert eine frühe Begegnung von Muslimen und Christen an Schutz, Zuhören und Ehrfurcht vor Maria und Jesus. Ein Gastbeitrag von Dr. Zeyneb Sayılgan.

Ich kehre immer wieder zu einem bedeutsamen Ereignis aus den allerersten Anfängen der islamischen Geschichte zurück. Diese erste Begegnung zwischen Muslimen und Christen erweckt in mir Hoffnung und hilft mir nicht in Verzweiflung zu geraten.
In einer Zeit, in der muslimische Migrant:innen und Flüchtlinge in Europa und den Vereinigten Staaten routinemäßig entmenschlicht und dämonisiert werden – reduziert auf Statistiken, Bedrohungen oder politische Instrumente –, besteht diese Geschichte auf einer anderen Möglichkeit. Sie erinnert mich daran, dass christlich-muslimische Beziehungen nicht mit Angst oder Gewalt begonnen haben, sondern mit Schutz, Gastfreundschaft und einer gemeinsamen Ehrfurcht vor Gott, Jesus und Maria.
Im siebten Jahrhundert riet der Prophet Muhammad (s) verfolgten Muslimen, Mekka zu verlassen und jenseits des Roten Meeres im christlichen Abessinien (dem heutigen Äthiopien/Eritrea) Zuflucht zu suchen. Dieses Königreich wurde von einem gerechten christlichen Herrscher regiert, der in islamischen Quellen als der Negus bekannt ist.
Als Gesandte aus Mekka eintrafen und die Auslieferung der Flüchtlinge forderten, tat der König etwas Bemerkenswertes: Er hörte zu. Er urteilte nicht, bevor er ihre Geschichte gehört hatte. Er lud die Muslime ein, selbst zu sprechen. Jaʿfar ibn Abī Tālib, der die Flüchtlinge vertrat, rezitierte Verse aus dem Koran über Maria und Jesus. Den Berichten zufolge weinte der König und erklärte: „Die Botschaft eures Propheten und die Jesu stammen aus derselben Quelle.“
Diese Aussage ist bis heute bedeutsam. Er zeigt mir, dass der gemeinsame Glaube an den einen Gott und die gemeinsame Liebe zu Jesus und seiner Mutter Maria ein Band schufen, das stark genug war, um die Angst vor dem religiösen „Anderen“ zu überwinden. Der König leugnete die theologischen Unterschiede nicht. Christen und Muslime waren sich eindeutig uneins über das Wesen Jesu und des Göttlichen. Doch diese Unterschiede verhinderten keine Solidarität. Die Muslime bekräftigten gemeinsame Werte – Gerechtigkeit, Fürsorge für die Armen, Schutz der Schwachen, Nächstenliebe und die spirituelle Gleichwertigkeit von Männern und Frauen. Dies war ein frühes Modell interreligiöser Integrität: Klare Gemeinsamkeiten und tiefe Differenzen gleichzeitig zu bejahen, ohne Zwang oder Verwässerung.
Diese Haltung ist heute notwendiger denn je. Zu oft werden muslimische Flüchtlinge verurteilt, bevor man ihnen zuhört. In öffentlichen Debatten über Migration bleiben sie Objekte der Diskussion statt Teilnehmende. Ich sehe politische Entscheidungen, die getroffen werden, ohne den Menschen zuzuhören, deren Leben davon am stärksten betroffen ist.
Der abessinische König bietet hier eine Korrektur: tiefes Zuhören als Akt des Glaubens. Menschen zu verurteilen, ohne ihre Geschichte zu kennen, ist inakzeptabel. Marginalisierte Stimmen zu stärken ist keine Wohltätigkeit; es ist Gerechtigkeit.
Ebenso eindrücklich ist, was der König nicht tat. Er begegnete den Flüchtlingen nicht mit einer utilitaristischen Denkweise. Er wies die Bestechungsversuche der mekkanischen Elite zurück. Er fragte nicht, welchen Nutzen diese Flüchtlinge seinem Reich bringen würden oder welche Lasten sie verursachen könnten. Er handelte aus einer Glaubensüberzeugung heraus, die in der Würde des Menschen gründet.
In unserer Zeit beginnen Migrationsdebatten häufig mit Berechnungen – wirtschaftlicher Gewinn, politisches Risiko, gesellschaftliche Kosten. So wichtig solche Erwägungen sein mögen, sie dürfen für Menschen des Glaubens nicht der Ausgangspunkt sein. Menschen sind keine Waren, und ihr Wert lässt sich nicht an ihrer Nützlichkeit messen.
Der Negus lehnte auch die Logik der Reziprozität ab. Er sagte nicht: „Ich werde euch schützen, wenn euer Volk meines schützt.“ Heute höre ich Argumente, westliche Länder sollten muslimische Flüchtlinge nur aufnehmen, wenn muslimisch geprägte Länder christliche Minderheiten gut behandeln. Doch Gerechtigkeit für eine Gruppe darf nicht vom Verhalten einer anderen abhängig gemacht werden. Flüchtlinge dürfen nicht zu Geiseln der Politik ihrer Regierungen werden. Treue zum Glauben verlangt moralische Klarheit, nicht transaktionale Großzügigkeit.
Gastfreundschaft steht im Zentrum dieser Begegnung. Sowohl in der christlichen als auch in der islamischen Tradition ist Gastfreundschaft oder Hospitalität nicht optional. Jesu Gebot, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, lässt keinen Raum für Ausschluss. Der Koran lehrt in ähnlicher Weise, dass Gott der gesamten Menschheit bereits Gastfreundschaft erwiesen hat, indem er während unseres vorübergehenden Aufenthalts auf Erden für Nahrung und Schutz sorgt. Den Fremden aufzunehmen bedeutet daher, göttliche Barmherzigkeit widerzuspiegeln.
Der muslimische Gelehrte Bediüzzaman Said Nursi bringt diese Haltung auf den Punkt, wenn er schreibt: “Die Barmherzigkeit des Glaubens umfasst jedes Geschöpf.” Glaube zeigt sich hier nicht in Abgrenzung, sondern in Verantwortung für den anderen – gerade dort, wo Macht, Angst oder politische Interessen zu Ausschluss drängen würden.
Der König gewährte den Muslimen Asyl, Religionsfreiheit und Schutz vor Verfolgung. Die Muslime wiederum sagten ihrer neuen Heimat Loyalität zu. Einige konvertierten sogar zum Christentum, andere blieben Muslime. Konversion geschah auf beiden Seiten, einschließlich – der islamischen Überlieferung zufolge – des Königs selbst. Diese Berichte wurden offen überliefert, ohne Verlegenheit oder Zensur, und zeugen von einem Selbstvertrauen, das aus Glauben und nicht aus Angst erwächst.
Die muslimischen Flüchtlinge isolierten sich nicht. Sie trugen wirtschaftlich bei, verteidigten Abessinien in Kriegszeiten und beteten für den christlichen Sieg gegen Aufständische. Sie hielten die örtlichen Gesetze ein und untergruben ihre Gastgeber nicht. Spätere islamische Rechtsgelehrte verwiesen auf dieses Beispiel, um zu argumentieren, dass Integration in eine nichtmuslimische Gesellschaft nicht nur erlaubt, sondern notwendig sei. Bildung, Spracherwerb und bürgerschaftliches Engagement galten als religiöse Pflichten. Würdevoll zu leben bedeutete, einen Beitrag für die Zivilgesellschaft zu leisten.
Muslime können mit Stolz auf eine lange Geschichte von Migration und Gemeinschaftsbeitrag zurückblicken – von Fortschritten in Medizin und Philosophie bis hin zu Kunst, Architektur und Landwirtschaft. Diese Leistungen entstanden nicht trotz des Glaubens, sondern wegen ihm. Doch das Ziel der Teilhabe war niemals Dominanz oder Zwangsbekehrung. Wie das abessinische Modell zeigt, teilten Christen und Muslime ihre spirituellen Schätze frei miteinander und respektierten zugleich die persönliche Entscheidung.
Wenn Menschen heute auf einem „Wir gegen sie“-Narrativ bestehen, leiden sie an dem, was Theolog:innen historische Amnesie nennen. Alle Glaubensgemeinschaften begannen am Rand. Alle waren einst verletzlich, vertrieben und auf die Barmherzigkeit anderer angewiesen. Die erste muslimische Gemeinschaft überlebte – ihrer eigenen Überlieferung zufolge –, weil ein christlicher König Mitgefühl über Angst stellte. Viele muslimische Gelehrte argumentieren, dass der Islam ohne diesen Schutz möglicherweise selbst nicht Bestand gehabt hätte.
Deshalb weigere ich mich, gesellschaftliche Narrative zu akzeptieren, die Muslime aus der westlichen moralischen Geschichte ausschließen. Die Geschichte Abessiniens gehört uns allen. Sie fordert sowohl die aufnehmenden Gesellschaften als auch die Einwanderungsgemeinschaften heraus. Sie ruft die Gastgeber dazu auf, aufmerksam zuzuhören, Entmenschlichung zurückzuweisen und eine im Glauben verwurzelte Gastfreundschaft zu praktizieren. Sie ruft die Neuankömmlinge dazu auf, sich einzubringen, beizutragen und die Gesetze und Werte ihrer neuen Heimat zu achten, ohne ihre Identität aufzugeben.
Diese heilige Begegnung ist nicht nur die Erinnerung an eine ferne Vergangenheit, sondern eine Vision einer noch kommenden Welt – einer Welt, die von aufrichtigen Menschen des Glaubens aufgebaut wird, denen die Liebe zur Menschheit wichtiger ist als der Triumph der eigenen Gruppe oder Theologie. An dieser Hoffnung halte ich fest. In einem Zeitalter von Mauern und Misstrauen steht das Bild Marias – von Christen wie Muslimen verehrt – noch immer zwischen uns und ruft uns zu unserer gemeinsamen Menschlichkeit zurück.